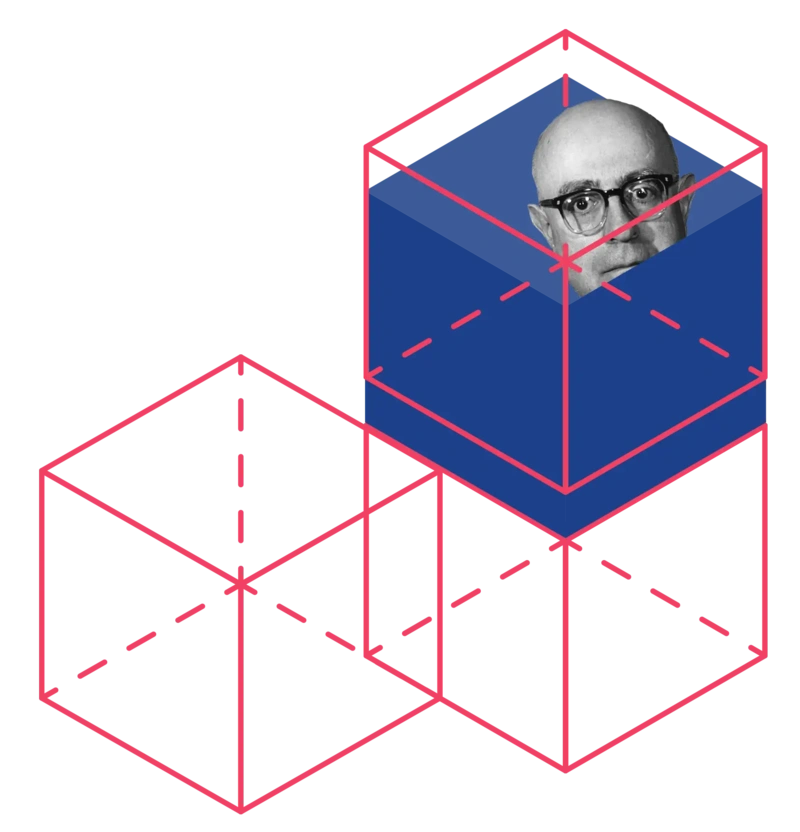
Totalität. Marx, Adorno und das Problem kritischer Gesellschaftstheorie
Am 18. September 2025 lud die Redaktion der AStA-Zeitung gemeinsam mit dem Institut für Sozialforschung (IfS) zur Buchvorstellung von Alex Struwes »Totalität. Marx, Adorno und das Problem kritischer Gesellschaftstheorie« ein. Der folgende Buchauszug, den wir mit freundlicher Genehmigung des Autors veröffentlichen, gibt einen Einblick in die Fragestellung des Buches: Wie lässt sich Gesellschaft als Ganzes begreifen und was bedeutet das für eine kritische Theorie der Gegenwart?
Was ist Totalität? Das Ganze, das Allgemeine, Allumfassende, System, soziale Struktur, Ordnung: Für Totalität gibt es viele Begriffe, und sie teilen alle das Problem, ob – und wenn ja, wie – es überhaupt möglich ist, die Gesellschaft als einen Zusammenhang zu begreifen. Es ist nicht leicht, diese Frage zu stellen. Totalität ist nichts, das man unvermittelt erfahren kann, das einem im Alltag begegnet. Sie ist ein Phänomen, das einem entgleitet, wenn man es fassen will – es entgleitet in die Abstraktion. Die Frage nach dem Ganzen wirkt so groß und allgemein, als sei es eine Art ewiges philosophisches Problem, wie etwa die Gesellschaft an sich oder der Sinn des Lebens. Hier liegt das erste Missverständnis: Denn dass eine solche Frage mit all den Folgeproblemen überhaupt denkbar wird, ist ein spezifisch moderner Umstand. Totalität hat eine konkrete historische Grundlage.
Die Totalität taucht auf
»Alles Ständische und Stehende verdampft.« Mit diesen Worten fassten Karl Marx und Friedrich Engels den Charakter der »Bourgeoisepoche« zusammen, deren Zeitzeugen sie zur Mitte des 19. Jahrhunderts geworden waren. Längst sind jene berühmten Zeilen aus dem berüchtigten »Manifest der Kommunistischen Partei« von 1848 zum geflügelten Wort geworden. Die eigentliche Bedeutung ihrer Beobachtung geht dabei gemeinhin unter. Denn die Bourgeoisie müsse zwar »sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend […] revolutionieren«, um zu existieren. Aber erst diese »ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände« ermöglichte eine bahnbrechende Erkenntnis: »die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen«.
Was sich den Menschen mit nüchternen Augen offenbarte, war, dass die Gesellschaft ein wirkliches soziales Verhältnis darstellt und dass sie diese als Ganze selbst einrichten. Die Beschreibung des Manifests ist eine Offenbarung der Bedingungen der Aufklärung und bürgerlichen Moderne: dass sich damals beobachten ließ, wie die ganze Gesellschaft einer so grundlegenden Transformation unterworfen wurde, war erst die Grundlage dafür, eine gesellschaftliche Veränderung ums Ganze zu fordern. Die Revolution, die Marx und Engels zur Durchsetzung einer menschlichen Gesellschaft anvisierten, wäre ein bloßes Hirngespinst und eine Wahnvorstellung, wenn nicht zuvor die Bourgeoisie eine solche historische Leistung vollbracht hätte. »Erst sie hat bewiesen, was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann.«
Die revolutionäre Leistung der Bourgeoisie hatte endgültig jede Vorstellung von natürlicher oder göttlicher Ordnung hinweggefegt, wie Marx bewunderte. Und damit verwies sie auf ein Problem: Das Ganze der Gesellschaft war zerbrochen – und darin überhaupt erst zu einer Frage geworden. Denn wie ließe sich vor diesem Hintergrund erklären, geschweige denn rechtfertigen, dass die Menschheit, befreit von der Notwendigkeit, nicht in ein Reich der Freiheit überging? Die »ewige Unsicherheit und Bewegung«, die an die Stelle all der festen und verknöcherten Verhältnisse getreten war, sie bildete selbst eine Ordnung des Ganzen und einen herrschaftlichen Zusammenhang. Jene revolutionäre Klasse »schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde«.
Hier tritt die Frage nach dem Gesamtzusammenhang der Gesellschaft auf. Es ist nicht so, dass alles Gesellschaftliche wie zufällig nebeneinander existiere und das Ganze also nur die Summe seiner Teile wäre. Es gibt einen bestimmten Zusammenhang des Ganzen. Und dieser existiert weder als höherer göttlicher Wille noch als tieferer Sinn, sondern zeigt sich im Einfluss auf seine Elemente. Es ist dadurch gleichsam ein bestimmender Zusammenhang. In Marx’ Perspektive zeigte sich Gesellschaft als Determinationsverhältnis, das als Ganzes eine Wirkung auf seine Teile hat, eine Wirkung, die im Allgemeinen besteht. Keine Personalisierung von Gottes Gnaden herrschte mehr, sondern die Herrschaft lag nun im gesellschaftlichen Prinzip, sie wurde abstrakt. Totalität ist in diesem Sinne ein zutiefst modernes Problem: Lassen sich diese gegenseitigen Verhältnisse der Menschen als bestimmter und bestimmender Gesamtzusammenhang begreifen? Und wie?
Dabei handelt es sich keinesfalls um eine rein scholastische Frage. Das Problem besteht allem voran als politisches. Totalität ist ein Aspekt von Gesellschaft, auf den unweigerlich stößt, wer sie grundlegend verändern will. Nahezu alle emanzipatorischen Bewegungen in der modernen bürgerlichen Gesellschaft gerieten an diese Grenze: Obwohl die Menschen ihre Geschichte selbst machen, warum lässt sich die Gesellschaft oder auch nur ein sozialer Missstand darin so schwer verändern? Aktuell ist im Diskurs um den Klimawandel eine diffuse Ahnung feststellbar, dass dringend etwas geändert werden müsse. Und es scheint den Menschen einigermaßen klar zu sein, dass kleine Schritte einzelner Akteure nicht ausreichen werden, sondern dass es eine Anstrengung der gesamten Gesellschaft bräuchte. Zugleich ahnt man auch, dass eine solche Zusammenarbeit unrealistisch ist. Intuitiv weiß man, dass Mechanismen existieren, die bestimmte Handlungskorridore öffnen oder schließen. Aber wie und warum?
Die Moderne und das Zeitalter der Aufklärung stellten eine freie und gleiche menschliche Gesellschaft den Idealen nach in Aussicht, aber alle Versuche zu deren Umsetzung oder auch nur zu grundlegenden Verbesserungen führten stets ebenso zu einer Verstetigung von Herrschaft und menschlichem Leid. Die Geschichte der Arbeiterbewegung und ihrer anvisierten Revolution ging in bürokratischen Massenparteien, sozialdemokratischen Reformen, ideologischer Verblendung und schließlich in einer Integration der Lohnabhängigen bis zur Unkenntlichkeit ihrer Beherrschung auf.
Der Kapitalismus – wie man gemeinhin glaubt, jene Bourgeoisepoche nach Marx auf den Begriff zu bringen – hat selbst seine schärfsten Kritiken integriert. Die Arbeiter bekamen ihren Industrielohn mit Eigenheim und Waschmaschine, die 68er ihre Selbstverwirklichung in der neoliberalen Eigenverantwortung und Kreativwirtschaft und die Frauenbewegung ihren gerechten Anteil an schlechtbezahlter Lohnarbeit. Die »Schere zwischen Arm und Reich« bleibt weit auseinander, die globale Ungleichheit ist dermaßen offensichtlich, jede emanzipatorische Errungenschaft durch potenziellen Backlash bedroht, Kriege und Klimakatastrophe haben längst gezeigt, dass dieses selbstzerstörerische System nicht trotz, sondern durch seine Krisen und »ununterbrochene Erschütterung« hindurch perfekt weiterläuft. Aber die Möglichkeiten, als »Gattungswesen« – wie das menschliche Potenzial zur Einrichtung der eigenen Verhältnisse bei Marx umstrittenerweise heißt – dagegen vorzugehen, erschöpfen sich in Fairtrade-Schokolade gegen die globale Ausbeutung und Papierstrohhalmen gegen den Klimawandel. Dass alles im Grunde so weitergeht wie bisher, macht eine Art Zwang deutlich, der die Gesellschaft als Ganze doch so zusammenhält.
2021 legte der dänische Marxist Søren Mau seine vielbeachtete Analyse eines solchen »Stummen Zwangs« der Verhältnisse vor. Gemeint war damit jene Herrschaft, die das Kapital über alle Mitglieder einer kapitalistischen Gesellschaft ausübe. Mau beruft sich damit selbstbewusst auf eine der großen marxistischen Thesen, dass sich die kapitalistische Gesellschaft als Ganze reproduziert. Was er aber ausspart, ist, dass genau in dieser These immer auch eine gefährliche Tendenz lag: Totalität als Antwort zu verstehen statt als Frage. Zu glauben, man habe die Sache in der Tasche, wenn man Kapitalismus und Totalität sagt, ist eine der irrigsten Vorstellungen der Linken. Die große Aufgabe, vor der eine materialistische Gesellschaftstheorie im Nachgang von Marx stand, liegt vielmehr in der Bestimmung, wie man sich dieses Ganze und dessen Fortbestehen überhaupt vorzustellen habe. Denn, auch so viel lässt sich aus der Geschichte lernen, die falsche Bestimmung des Ganzen kann katastrophale politische Folgen zeitigen.
Das Ideologieproblem der Totalität
Bis heute ist der Begriff Totalität daher mit der Vorstellung eines feststehenden Ganzen der Gesellschaft verbunden, in dem alles seinen Platz hat, determiniert und unbeweglich ist. Tatsächlich gibt es Bestimmungen der Gesellschaft, die diese wie einen Organismus begreifen, in dem alles für das Ganze ineinandergreift und den man entsprechend von Krankheitserregern reinigen müsse. Gesellschaft wurde sich aber auch wie im ökonomischen Reduktionismus des »Betonmarxismus« als das bloße Abbild beziehungsweise der Reflex einer ökonomischen Basis vorgestellt. Des Weiteren gibt es die vormodernen Visionen von Gesellschaft als Ausdruck einer höheren Ordnung, die mit der nötigen Gewalt zu ihrer wahren Form gebracht werden müsse.
Dies sind falsche Vorstellungen. Die Falschheit dieser Bestimmungen lässt das Problem jedoch nicht verschwinden, das mit dem Begriff Totalität benannt wird. Statt Totalität als Möglichkeit der Erkenntnis der Gesellschaft ganz fallen zu lassen, wird die Aufgabe umso dringlicher, den wirklichen Zusammenhang des Ganzen zu bestimmen. Wer es ernst meint mit dem modernen aufklärerischen Anspruch, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist« (Marx), kann sich keine Fehleinschätzung des Zusammenhangs leisten, mit dem man es zu tun bekommt.
Denn diese Gesellschaftsform bringt noch eine weitere Schwierigkeit mit sich: Sie reproduziert sich nicht nur durch Zwang oder letztendlich Gewalt, sondern auch dadurch, dass man sich die falsche Vorstellung über sie macht. Diese falschen Vorstellungen nennt man Ideologie. Gemeinhin versteht man unter dem Begriff eine Art politisch imprägniertes Weltbild, also eine Deutung der ganzen Welt von einer spezifischen Annahme aus. Um den Marxisten Louis Althusser zu paraphrasieren, ist Ideologie aber auch jener Mechanismus zur Reproduktion der bestehenden Verhältnisse, der die Form der Ideen und Gedanken, ja des Bewusstseins betrifft. Ideologisch ist ein Denken da, wo es diese gesellschaftliche Funktion erfüllt. Ein klassisches Beispiel dafür ist Naturalisierung: Menschengemachte Verhältnisse erscheinen dann wie unveränderliche Naturnotwendigkeiten und sind so vor Veränderung geschützt, weil sie als solche nicht einmal erkennbar sind.
Oft wird sich Ideologie vorgestellt wie im Film »Matrix«, jener prototypischen Verschwörungstheorie, die nicht umsonst zur Ikone der Neuen Rechten geworden ist (obwohl sie als linke Fantasie angetreten war): Ausbeutung und Herrschaft würden durchgesetzt, indem den Menschen eine falsche Realität und Simulation vorgegaukelt werde, die sie beruhigt und beschäftigt alles hinnehmen lässt. Ideologie sei folglich eine Art Schleier, den es zu zerschlagen gelte. In letzter Konsequenz ist das eine sehr alte, mythische Vorstellung davon, dass das Denken und die Welt mit einem Befreiungsschlag wieder eins werden könnten.
Es gibt gute Gründe, einem solchen Ende der Entfremdung mit Skepsis zu begegnen. Woher weiß ich, ob die Idee der alles umfassenden Simulation, der man sich entziehen müsse, nicht selbst nur eine systematisch verzerrte Vorstellung ist? Halte ich also mit unbeirrbarem Glauben daran fest, dass es so sei, oder folge ich der Skepsis in den Relativismus, dass es eh keine Wahrheit gebe, alles folglich Ideologie sei, bis hin zum nihilistischen Zweifel an der Realität selbst, den der Kulturtheoretiker Mark Fisher »ontologischen Terror« nannte? Alles ist determiniert oder nichts wirklich wahr – dieser Widerspruch lässt sich drehen und wenden, wie die Philosophiegeschichte bewiesen hat.
Die Skepsis gegen die Ideologie könnte jedoch ebenso in eine andere Richtung führen, nämlich zur Selbsterkenntnis: Die Aufgabe besteht dann nicht darin, die Differenz zwischen dem Denken und der Welt zu überbrücken, sondern sie zu begreifen und sinnvoll begründen zu können, um gegen Ideologie eine Chance zu haben. Dafür aber muss ich das Totalitätsproblem der Ideologie ernstnehmen: Wenn die Gesellschaft einen bestimmten und bestimmenden Gesamtzusammenhang bildet, umfasst dieser auch das Denken, also die Vorstellungen, die ich mir von dieser Gesellschaft mache. Aber wie nun gelange ich zu einer Vorstellung des Ganzen, die nicht einfach nur unbewusstes Produkt jener Verhältnisse ist, die sie erkennen soll, um sie zu verändern? Und wie kann ich sicherstellen, dass meine Antwort auf diese Frage nicht nur eine Verdrängung des Problems ist, die lediglich dafür sorgt, dass es eine Zeitlang unsichtbar wird?
Totalität und Selbstkritik
Wenn es einen Gesamtzusammenhang gibt, der die Gesellschaft als ein Herrschaftsverhältnis bestehen und fortbestehen lässt, dann muss dieser erkannt werden – und zwar ohne ihm so auf den Leim zu gehen, dass sich die Erkenntnis in die Reproduktion des Gesamtzusammenhangs einfügt. Für dieses Vorhaben gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist: Diesem Problem widmet sich eine ganze Theorietradition materialistischer Gesellschaftstheorie von Marx bis mindestens in die Kritische Theorie. Die schlechte Nachricht: Diese liegt fallengelassen und unter Missverständnissen verschüttet brach.
Bereits 1964 gestand Theodor W. Adorno, dass eine solche Skepsis gegen die Theorie auch ihr »historisches Recht« besitze. Den Zuhörenden seiner Vorlesung über »Philosophische Elemente einer Theorie der Gesellschaft« referierte er, dass die Abwesenheit einer Theorie der Totalität damit zusammenhänge, »daß die gegenwärtige Gesellschaft in sich eine so komplex und schwierig konstruierte Sache ist, daß sie der Theorie, jedenfalls in dem zunächst einmal naiven Sinn, der einstimmigen, ungebrochenen, unmittelbaren Erklärung aus einigen Begriffen, sich widersetzt«. Aber im Unterschied zur heutigen Situation, in der die Frage mit der Schwierigkeit gleich ganz verworfen wird, hielt Adorno fest: »das Moment, das darin sich anmeldet, muß selbst in eine Theorie aufgenommen werden«.
Wie nehmen aktuelle Theorien und Diagnosen dieses Moment in sich auf? Mit den Superlativen von Vielfachkrise, Klimakatastrophe, Weltuntergang und globaler Regression kehren auch Kapitalismuskritik, Klassenanalysen und Gesellschaftstheorien wieder: Die Zeichen häuften sich, dass »alle Leiden ein und demselben System [entspringen]«, wie die Philosophin Nancy Fraser zu ihrer Kapitalismuskritik »Der Allesfresser« sagte. Aus den Krisen der Gegenwort folge ein »immer drängenderes Interesse der Öffentlichkeit an umfassenden Theorien der Gegenwartsgesellschaft, ja der menschlichen Gesellschaft und Geschichte in ihrer Gesamtheit«, das die Soziologen Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa zur »Spätmoderne in der Krise« diagnostizierten. Deshalb wage man sich wieder an »eine Gesellschaftsanalyse […], die aufs Ganze geht«, wie jüngst der Politikwissenschaftler Kolja Möller in seiner »Gesellschaftstheorie des Populismus«, oder an eine »richtig verstandene Geschichtsphilosophie« zur Erklärung des großen Ganzen, wie die Sozialphilosophin Rahel Jaeggi in ihrem letzten Buch »Fortschritt und Regression«.
Aber diese Ansätze nehmen das Ganze, die Struktur und Determination zwar wieder in den Blick, aber nur als abstrakte Bestimmungen. Diese Tendenz zur bloßen Abstraktion markiert jedoch den Übergang der Theorie in Ideologie. Und so bleibt auch in der gegenwärtigen Rückkehr der großen Fragen ums Ganze Totalität das Problem, mit dem es jede kritische Gesellschaftstheorie zu tun bekommt. Aus der ideologischen Tendenz, in die das Denken scheinbar immer abdriftet, muss sie die Konsequenz ziehen, mittels Selbstkritik am Denken selbst gesellschaftliche Objektivität nachzuvollziehen.