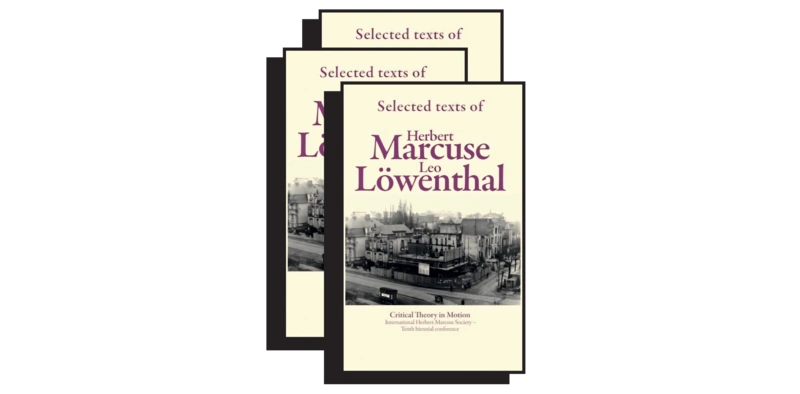
Rezension: Critical Theory in Motion
Anlässlich der zehnten Konferenz der Internationalen Herbert Marcuse Gesellschaft hat diese, mit Unterstützung der Universität Frankfurt und insbesondere des dortigen ASTA, ausgewählte und bisher unveröffentlichte Texte von Herbert Marcuse und Leo Löwenthal herausgebracht und in einem Band vereint.
Das Buch wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Nachlassverwalter von Marcuse und Löwenthal, Peter Erwin-Jansen, und Inka Ingel erstellt und gibt exklusive Einblicke in das Werk der beiden Philosophen der Kritischen Theorie. Viele der Texte beschäftigen sich mit zentralen Fragestellungen, die sich die beiden Denker der Kritischen Theorie schon vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges oder kurz danach zum Antisemitismus und der Shoah gestellt hatten.
Nach den Vorworten der Herausgeber*innen des AStA und des Leiters des Institut für Sozialforschung, Stephan Lessenich, widmet sich die erste Hälfte des Bandes den Beiträgen von Marcuse.
Den Anfang macht der Essay »The Containment of Social Change in Industrial Society«, welcher aus dem Transkript einer Vorlesung in Stanford 1965 entstanden ist. Der Beitrag ist im englischen Original und deutscher Übersetzung hier erstmals abgedruckt und veranschaulicht in hoher Dichte Marcuses Gesellschaftskritik. Zentral ist hierin sein Technologiebegriff: die Entwicklung der technologischen Gesellschaft habe diese nicht im Sinne des Fortschritts freier gemacht, sondern ein vollendetes Herrschafts- und Unterdrückungsinstrument geschaffen. Dies spitzt er auf Seite 39 zum „Paradox der Wohlstandsgesellschaft« zu. Trotz dieser negativen Beobachtung beendet Marcuse seinen Text mit einem optimistischen Ausblick. Durch das Erkennen der Widersprüche kann dies in praktische Opposition zu dieser Herrschaft führen, wie man beispielsweise anhand der Bürgerrechtsbewegung sehen kann. Marcuse betont hier demnach die in der Kritischen Theorie zentrale Verbindung von Theorie und Praxis.
Den zweiten Beitrag verfasste Marcuse zusammen mit Franz Neumann und trägt den Titel »A history of the doctrine of social change«. Der Text ist wohl in den 1930ern entstanden, als beide in New York zusammen arbeiteten. Behandelt wird hier der Wandel des Begriffs »Social Change« in der Philosophiegeschichte. Die Autoren unterteilen hier in drei Abschnitte: Klassische griechische Philosophie, mittelalterlich-christliche Lehre und die Loslösung des Begriffes von Glauben und Theologie, beginnend mit Machiavelli bis hin zu Hegel und Marx. Der dritten Phase wird hier besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Im vierten Abschnitt wird herausgearbeitet, wie über Hegel und Marx die moderne Soziologie die Verbindung zwischen Sozialtheorie und Philosophie hergestellt hat. Zum Abschluss wird auf eine Fortsetzung verwiesen, in der es um die Sozialtheorie im Lichte des Faschismus gehen soll.
Der letzte Beitrag von Marcuse »Antisemitism and American Labor« ist ein Auszug aus einem Forschungsprojekt des Institute of Social Research, Columbia, 1944. Die Forschung bildete die Grundlage für einen 1400-Seiten langen Report über den Antisemitismus in der amerikanischen Arbeiterschaft, in Auftrag gegeben vom Jewish Labor Committee, welcher aber nie veröffentlicht wurde. Der Auszug bietet einen interessanten Einblick in die Forschung von Marcuse, welcher damals von starker Sorge getrieben war, dass der Antisemitismus ähnlich wie im Dritten Reich in der amerikanischen Arbeiterschaft Fuß fassen könnte.
Der erste Text von Löwenthal ist passend ein Brief an Marcuse aus dem Jahr 1943. Der Brief zeigt deutlich, wie intensiv Marcuse, Löwenthal und die Mitarbeiter*innen des Institutes an den Diskussionen über Autoritarismus und Antisemitismus beteiligt waren, die auch Horkheimer und Adornos parallele Arbeit an der Dialektik der Aufklärung befruchtete.
Der nächste Beitrag trägt den Titel »Terror’s Atomization of Men«, stammt aus dem Jahr 1945 und ist ebenfalls ins Deutsche übersetzt. Behandelt werden hier eine der zentralen Fragestellungen der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule: Wie sind Faschismus und die Krise des Individuums in der modernen Gesellschaft miteinander verknüpft? Diese Krise bezeichnet Löwenthal als »Atomisierung des Individuums«. Er beschreibt, wie der Terror des Faschismus das Individuum zersetzt und schließlich assimiliert und dadurch zum Komplizen des eigenen Systems macht. Wie auch der erste Beitrag von Marcuse, schließt Löwenthal aber seinen Text mit einem optimistischen Ausblick ab. Dank der auf Theorie und Praxis fußenden Vernunft kann der Mensch sich aus dieser Atomisierung befreien.
»Atomisierung des Individuums« und »The Containment of Social Change in Industrial Society« sind insbesondere durch die optimistischen Abschlüsse die lesenswerten Beiträge des Bandes. Marcuse und Löwenthal zeigen hier den Ausweg, welchen die Kritische Theorie aus den Widersprüchen und Zwängen der modernen Gesellschaft bietet. Nur wenige Jahre nach dem vollständigen Bekanntwerden der industriellen Vernichtung des Faschismus analysierten sie nicht nur die Gründe für den Zivilisationsbruch, sondern zeigten auch eine Alternative auf.
Der nächste Beitrag ist ein Interview von Löwenthals mit Erkki Vainikkala von 1980. Anders als die vorigen Texte stammt das Interview aus einer deutlich späteren Schaffensphase und behandelt sowohl die Geschichte der Kritischen Theorie als auch aktuelle politische Entwicklungen. Daneben zeigt das Gespräch auch Löwenthals streitbaren Charakter, welcher auch Spitzen gegen andere Vertreter*innen der Frankfurter Schule nicht scheut.
Auch der letzte Text Löwenthals stammt aus den 80ern. »Reden über das eigene Land« reflektiert seine biografische Verortung in der Kritischen Theorie und als Deutscher, der nach dem Krieg nicht ins eigene Land zurückgekehrt war. Interessant sind hier Löwenthals Bemerkungen zu Adornos Theorie und dem Wandel, welche diese erfahren hat.
Im Gegensatz zu den Beiträgen von Marcuse, welche sich ausschließlich mit wissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen, sind die Texte von Löwenthal auch persönlicher Natur. Die Selbstreflexion seiner Rolle in der Kritischen Theorie und die Verortung in politischen und akademischen Debatten sind eine Bereicherung für das Forschungsfeld. Aber auch die Beiträge von Marcuse geben einen interessanten Einblick in das Wirken der Denker, insbesondere unter dem Hinblick des Faschismus und dem daraus resultierenden Exil. Für die zeitgenössische Forschung zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schule ist es ein Gewinn, dass dank der Herbert Marcuse Gesellschaft und der Unterstützung des ASTA der Goethe Universität die Auswahl der Texte publiziert werden konnte.