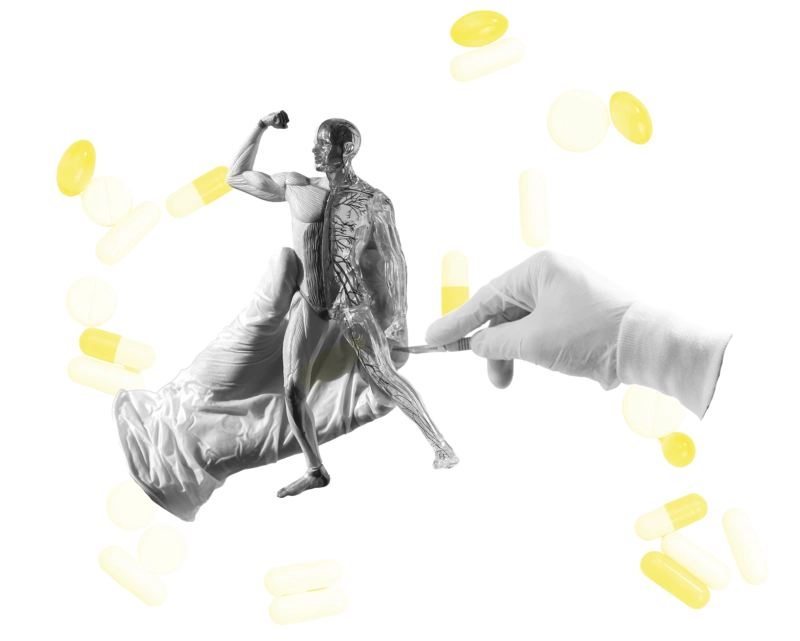
Körper-Sein als Leistung?
Die Imperative der Selbstbemächtigung und die leibliche Existenz
Körper-Sein als Leistung? Diese Frage ist für das Selbstverständnis des Menschen in der technisch-wissenschaftlich-kapitalistischen Zivilisation geradezu symptomatisch. Der Zugriff auf Natur und Welt, die Hypostasierung des biblischen Auftrags ›Macht Euch die Erde untertan‘, hat vor dem menschlichen Körper nicht haltgemacht. Die Erfolge der Transplantationsmedizin erwecken den Eindruck, dass Körperteile beliebig ›ersetzbar‘ sind. In Ei- und Samen-, ja selbst Embryonenbanken lagern stets verfügbar die Lebensressourcen. Die Reproduktionsmedizin suggeriert, dass Kinder nach Wahl ›herstellbar‘ sind und problemlos von Leihmüttern ausgetragen werden. Das Gebären soll planbar ›erledigt’ werden. In genetischen, endokrinologischen und chirurgischen Eingriffen erscheint selbst das Geschlecht des Menschen als ›verhandelbare Ware‘, seine äußere Erscheinung jedenfalls beliebig gestaltbar.
Zugleich sehen wir für uns selbst gern in Bildern des technik- und naturwissenschaftlichen Körpermodells: Wir haben etwas ›auf dem Schirm‘ und ›speichern ab‘; Denken ist Datenverarbeitung; verliebt man sich, heißt es, dass Hormone verrücktspielen; Essen wird zum Auftanken, Schlafen zum Akku-Laden; der morgendliche Kaffee bringt den Motor in Schwung, der abendliche Alkohol kühlt ihn herunter; der Gesundheitscheck kommt einer TÜV-Prüfung gleich und Fitness-Coaches organisieren das body-enhancement. Und spielt der Körper einmal nicht mit beim Ableisten des Lebensprogramms, greift man zu Aufputsch- und Schlafmitteln oder verlangt gleich nach neuer Hard- oder Software.
Kurzum, der Körper wird als durch das Ich nahezu restlos verfügbar gedacht und Körper-Sein unter das Paradigma einer geradezu utopischen Struktur gestellt: Immer leistungsfähiger, stärker, schlanker, schöner, fitter soll der Körper sein. Das einmal Erreichte gilt es zu überbieten, Grenzen zu verschieben. Körper-Tuning, ein Begriff aus der Maschinenwelt, steht hier für eine Vielzahl von Maßnahmen zur Erscheinungs- und Leistungssteigerung. Dass dabei Yoga und Meditation neben Krafttraining und Fettabsaugen, Permanent-Make-up und Penisverlängerung im Angebot sind, erscheint keineswegs erklärungsbedürftig. Heute werden offenbar alle möglichen Körpertechniken zur Lebensoptimierung instrumentalisiert – der Körper ist das Projekt der Spätmoderne.
Mit dem manipulativen Zugriff auf den Körper als Objekt gerät jedoch häufig der Leib in den Hintergrund, also der gespürte Körper als Quelle von Subjektivität, und das biographisch geformte leibliche Selbst, das personale Identität stiftet. Noch im 11. Jahrhundert gab es für den menschlichen Körper ausschließlich den Begriff Leib, der den belebten Leib vom Leichnam, dem leblosen Körper abgrenzte. Dieser lebendige Leib wurde in der Neuzeit mehr und mehr zum Körper als Objekt, Instrument, Werkzeug, Maschine, ja bloßes Material. Die Einheit des Leibes trat gegenüber einer Zerlegung des Körpers in Einzelteile zurück, bis hin zu feinstofflichen Kleinstpartikeln.
In der Spätmoderne wird der Körper als objektivierbarer Leistungsträger, ja geradezu als ›kritischer Erfolgsfaktor’ präpariert. Menschen werden im Berufsleben nicht nur nach ihrer Leistung beurteilt, sondern auch nach ihrer body-performance. Schöne, fitte und gesunde Menschen werden bei Bewerbungen und im Privatleben bevorzugt, jedenfalls suggerieren das überaus mächtige, rund um die Uhr kolportierte und mittlerweile auch algorithmisch selektierte Körper-Bilder. Körper-Sein soll geleistet werden, und es scheint zunehmend schwieriger, sich den Imperativen zu entziehen: Schon Kindergartenkinder interessieren sich für ihr Gewicht, Grundschüler*innen haben Erfahrung mit Diäten, Pubertierende denken über operative ›Verbesserungen‘ nach, und wer nicht mitspielt im Karussell der Eitelkeiten, erlebt Ausgrenzung und Körperscham.
Gerade an biographisch relevanten Übergängen wartet die Gesellschaft mit massiver Kulturalisierung auf, so dass Identitätsbildung stark vom somatischen Habitus bestimmt wird. Körperliche Umbruchphasen werden bewertet, teils regelrecht pathologisiert und mit Verhaltensnormen belegt. In der weiblichen Biographie betrifft das z.B. die Thelarche (das Brustwachstum), die Menstruationen, die sexuellen Skripte, Schwangerschaft, Geburt, Laktation, Wochenbett, Klimakterium (vgl. Gahlings 2016). Dazu gehören die Moden körperlicher Performativität, hygienische Imperative, medizinische Maßnahmen, aber auch Einstellungen zum Körper oder Ansprüche an Normalisierung und Planbarkeit. So gilt es z.B. als Leistungsziel, wenige Wochen nach der Geburt wieder eine Top-Figur zu präsentieren – als wäre nie etwas gewesen. Zur Disziplinierung rund um die Projektförmigkeit des Lebens gehört, dass die Vorzeichnungen des weiblichen Leibes in der Regel nicht mit den Körperkonstrukten der Schönheitsindustrie korrelieren. Millionen von Frauen kennen sogenannte ›Problemzonen’, wissen um das, was an ihrem Körper ›besser’ sein könnte, und entwickeln ›somatische Projekte’: Schminken und Haare färben; Atmen und Gehen unter dem Diktat bizarrer Kleider- und Schuhmoden; Investieren von Zeit, Kapital und Schmerz in kosmetische und chirurgische Behandlungen; Konsum von Anti-Aging-Produkten; Besuche in Fitness-Studios und Wellness-Oasen; Erwerb von Diät-Präparaten; schließlich die Diät selbst, die nicht etwa als asketisches Fasten den Verlockungen eines sakralen Heilswegs nachgibt, sondern den Verheißungen auf Selbststiftung von geschlechtlicher Identität. Food fetischism ist zu einem Feld geworden, »auf dem … es auch um die Anerkennung/ Nichtanerkennung der Individuationszwänge, um die Körperideale und die sexuelle Differenz« vor allem von Frauen geht (H. Böhme 2006, 468). Dies erscheint vor dem Hintergrund des Erkenntnisgewinns durch die Frauenemanzipation, die politischen Frauenbewegungen und die feministischen Theorien geradezu absurd. Der Schönheitskult hat sogar mit invasiven Verfahren längst die Geschlechtsteile erreicht, und ›sexuelle Fitness‘ ist durch allseits verfügbare Pornographie im digitalen Raum ein wichtiger Teil des Leistungsspektrums.
Natürlich reagieren auch Männer zunehmend auf die für sie vorgesehenen medial vermittelten Körperideale. Das eigene Aussehen wird ihnen wichtiger und zugleich betrachten sie sich selbst kritischer. Die Herrenkosmetik – ein lang belächelter Wirtschaftszweig – ist mit offensiven Werbekampagnen auf dem Vormarsch und weiß sich eine immer jüngere Klientel zu erschließen. Fußballstars sind hier oft Trendsetter. Auch Männer beginnen sich vor Falten zu fürchten, cremen ihre Haut, lassen sich Botox injizieren, konsumieren Potenzmittel, färben die Haare, rasieren sich Achsel und Brust, zahlen aber auch für Haartransplantationen, nehmen Appetitzügler oder greifen zu invasiver Körperformung.
So wird eine stetig steigende Summe von Kapital und Lebenszeit darauf verwendet, Gegebenes in Gemachtes zu verwandeln. Die kulturellen Imperative zielen auf eine nie da gewesene Objektivierung und Fetischisierung des eigenen Körpers. Die sozialen Medien und der Kult um das Selfie tragen massiv dazu bei. Die Differenz zwischen dem Gegebenen und dem Erreichbaren stiftet zusammen mit dem ständig präsenten Markt der Möglichkeiten einen Kreislauf des Leistungsdrucks. Gleichwohl haben wir es hier mit einer expliziten Rhetorik der Freiheit zu tun. Die Unterwerfung unter die herrschenden Körper-Politiken wird gar nicht als Zwang wahrgenommen: Es scheint eine verbreitete Überzeugung zu sein, dass Anstrengung, Entbehrung und Qual notwendig sind, um den Körperidealen gerecht zu werden. Der uralte Spruch »Wer schön sein will, muss leiden« wird heute imperativisch umgedeutet: »Du sollst schön sein, weil Du schön sein kannst!«, koste es, was es wolle.
In gewisser Hinsicht ist der Wellness-Trend wohl ein Lichtblick. Immerhin treten das aktive Tun und die ›Gegnerschaft‘ zum Körper zurück. Sich-Wohlfühlen tönt das Motto und eine unüberschaubare Gruppe von Körper-Expert*innen sagt uns wiederum, wie das nun geht. Handelt es sich um ein weiteres Projekt? Jedenfalls steht selbst die Wellness-Kultur in Gefahr, ein Rädchen im Kreislauf des Leistungsdrucks hin zum Körper-Sein zu werden, wenn auch sie instrumentalisiert wird und Power-Napping, Blitzentspannung oder der perfekte Schlaf zu Leistungszielen avancieren, damit die Selbstausbeutung noch effizienter gelingt.
Sicher ist dem Reich der Freiheit, das sich durch den Schönheits-, Fitness- und Gesundheitskult erschließt, auch Positives abzugewinnen. Body-sculpturing eröffnet zweifellos viele Wege der Selbstinszenierung, gerade auch im Kontext fluider Geschlechtlichkeit, und ist nicht in jeder Hinsicht leibfeindlich. Der Körper ist ein wichtiges Terrain persönlichen Ausdrucks und es gehört zu jeder Biographie, sowohl ein Verhältnis zu den gesellschaftlichen Ansprüchen an das Körper-Sein zu entwickeln als auch mit körperlicher Ertüchtigung den Schäden unserer Bewegungsträgheit entgegenzuwirken. Letztlich geht es weniger um dieses oder jenes Ideal bzw. diese oder jene Körper-Technik. Problematisch ist vielmehr, dass das Streben nach restloser Verfügbarkeit wenig Spielraum für eine Affirmation des Gegebenen lässt. So schwindet auch die Fähigkeit, sich mit den regressiven Aspekten des Lebens zu arrangieren. Müssen wir also nicht ein wenig abrücken von den vielbeschworenen Selbsttechnologien im Sinne des Bemächtigens aus Freiheit? Wie steht es um die viel schwierigere Aufgabe, sich in dem zu finden, was uns gegeben ist und in Unfreiheit lässt? Brauchen wir nicht dringlich eine Revitalisierung der philosophischen Selbstsorge mit Antworten auf die Frage nach einem guten, gelingenden Leben in der technisch-wissenschaftlich-kapitalistischen Zivilisation?
Hier tut wohl not, die etablierten Welt- und Menschenbilder fortlaufend einer philosophischen und dabei auch einer erneuerten feministischen Kritik zu unterziehen. Lebensformen sind ja keine Naturgewächse, wie Rahel Jaeggi treffend schreibt, sondern, »lernende Lernumgebungen« (Jaeggi 2014, 330ff.). Sie können mehr oder weniger gelingen und sie sind veränderbar. Man könnte es sogar als moralischen Auftrag verstehen, den kulturbedingten Deformationen entgegenzuwirken. Dazu gehört heute, dem Hyperindividualismus und dem Turbo-Kapitalismus mit einer Ethik des Miteinanders und des Gemeinwohls entgegenzutreten. Dazu gehört, der Kritik- und Urteilsfähigkeit sowie der Begegnungsoffenheit mehr Gewicht beizulegen. Dazu gehört nicht zuletzt eine Besinnung auf die leibliche Genese des Menschen und die Komplexität seines Empfindens, zumal ein verkümmertes Gespür für die Gefühlsräume sich häufig als Kernproblem des Selbstverhältnisses und der Gemeinschaftsbildung präsentiert. Tritt die bedürftige, verletzliche, berührbare Seite des Menschen und wohlwollend-mitfühlende Intersubjektivität zurück, muss man mit verheerenden Konsequenzen auch für den politischen Zusammenhalt rechnen (vgl. Nussbaum 2012).
Im Verstehen der Bedürftigkeit des Menschen und seiner Eingebundenheit in das Gewebe der Welt, richtet sich Philosophische Selbstsorge mit der individuellen Lebensführung immer auch auf das Gelingen von Gemeinschaft. Mit einer solchen Sorge-Praxis kann man vielleicht den Verwerfungen unserer Gegenwartskultur entgegentreten, den Spielraum leiblicher Selbst- und Welterfahrung neu erschließen und politisch-gesellschaftlich gestaltend einwirken. Damit ist auf das Ethos verwiesen, als einer in moralischen Haltungen verankerten Ausrichtung auf sich selbst, die anderen Menschen und den gemeinsamen Lebensraum. Heute ist z.B. die Philosophische Praxis ein wichtiger institutionalisierter Ort für die Förderung dieser philosophischen Lebenskunst (vgl. Gahlings 2023). Es geht um moralische Existenz und den moralischen Diskurs im Hinblick auf die von Gernot Böhme formulierten ernsten Fragen danach, was für ein Mensch man ist und in welcher Gesellschaft man leben möchte (vgl. G. Böhme 1997).