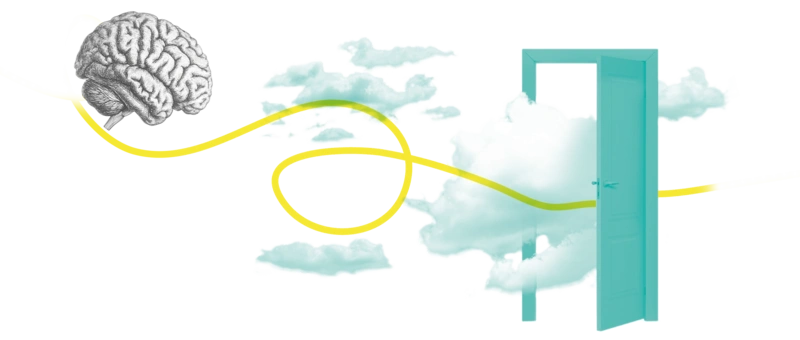
Body in transition
please handle with care
Körper sind eigensinnig, sie haben ihre eigene Logik, ihr eigenes Tempo – sie machen Sachen, die man nicht bewusst erwartet, geschweige denn geplant hat. Das Gehirn als Teil des Körpers kann nur bis zu einem gewissen Grad realistische Vermutungen darüber anstellen, was bestimmte Entscheidungen für Folgen haben werden. Wenn aber Prozesse einsetzen, für die das Gehirn keine biographische Blaupause hat, ist es nicht mehr besonders gut darin, zu antizipieren, was möglicherweise passieren wird.1 So gesehen, war es etwas naiv von mir, meinen Text über meinen Brustkrebs in der 2024 erschienenen Brüste-Anthologie mit dem starken Statement zu beenden »Was mich nicht stört: dass ich eine Brust habe«. Als ich das schrieb, war es zwar wahr, dass ich halbwegs zufrieden mit dem Zustand nach meiner einseitigen Mastektomie war. Das war auch noch der Fall, als ich den Text auf der Premiere im Juni 2024 vortrug.
Wenn ich aber geahnt hätte, wie sehr das nur ein dreiviertel Jahr später sowas von nicht mehr richtig sein würde, hätte ich das wohl eher nicht so betont. Mittlerweile stört mich meine eine Brust massiv und oft, aber nicht, weil es »nur« eine ist, sondern weil sie überhaupt da ist.
Ich bin nicht binär (oder besser: ich benutze diese Bezeichnung, weil das »nicht« darin am besten zu meinem Verhältnis zu geschlechtlicher Identität passt). Das ist mir erst während meiner Brustkrebserkrankung richtig bewusst geworden. Vorher konnte ich in meiner Berliner linken feministischen Bubble mehr oder weniger zurückgezogen leben, ohne allzu viel störenden Kontakt mit Erwartungen an scheinbar normale Gender- und sonstige Performance. Mit der vermeintlich weiblichen Krankheit Brustkrebs fand ich mich aber plötzlich in einer Welt wieder, in der mir ständig angenommene weibliche Sorgen und Bedürfnisse zugeschrieben wurden. In diesem vergeschlechtlichten medizinischen Setting fiel mir erst auf, dass mich das alles nicht betraf und ansprach — nicht, weil ich so links oder alternativ war (obwohl das sicher eine Rolle spielt), sondern weil ich gar keine Frau bin.
Als ich im Dezember endlich meinen Termin beim Standesamt Neukölln hatte, um meinen Geschlechtseintrag nach dem neuen Selbstbestimmungsgesetz streichen zu lassen und meinen Namen zu ändern, hatte ich angenommen, dass dies wahrscheinlich der vorläufige Schlusspunkt meiner Transition sein würde. Selbst Transition kam mir als ein zu großes Wort für diesen Prozess vor, wollte ich doch hauptsächlich in Ruhe gelassen werden mit dieser ganzen Vergeschlechtlichung. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass das Amt meine Namenswahl nicht akzeptieren würden, dass ich mich würde streiten müssen, um meinen alten Rufnamen zu behalten und nur einen Vornamen zu ersetzen und das auch noch in einer anderen Reihenfolge. Ich fand das praktischer, und »Kirsten« ist tatsächlich ein Name, den man für weibliche und männliche Personen verwenden kann, also quasi ein nicht binärer Name. Ich wusste nicht, ob ich mich an meinen neuen Namen »Sasha« wirklich gewöhnen würde, ich hatte ihn mir hauptsächlich zurechtgelegt, um die Beamt*innen mit einem bekannteren, als für »beide« Geschlechter anerkannten Namen beruhigen zu können. Beim Amt war es dann überraschend entspannt und unkompliziert – noch überraschender war allerdings, dass diese Änderung einen push bewirkte, als wäre eine Tür für Veränderung und neue Bedürfnisse aufgegangen, die ich lange vor mir selbst verschlossen gehalten hatte.
Unangenehmerweise hatte ich erstmal mehr dysphorische Gefühle statt der erhofften Euphorie. Ich hatte angenommen, dass ich ein wenig bürokratischen Aufwand haben würde, alle Angaben überall zu ändern, mich aber dann endlich nicht mehr darüber streiten würde müssen, dass ich nicht als Frau angesprochen werden möchte. Und dass ich damit froh und zufrieden sein würde.
Vor allem im medizinischen Kontext war ich oft zurückhaltend, mich zu outen – mit einer akuten oder chronischen schweren Krankheit muss eins Prioritäten setzen was man dem medizinischen Personal an Aufmerksamkeit und Zuwendung abverlangen kann und für welche Auseinandersetzungen und Gespräche man die Energie hat. Deswegen war es mir wichtig, meine Krankenkassenkarte schnell zu ändern. Als mich letzte Woche eine Ärztin mit »Kirsten Achtelik« aufrief statt mit dem bisher üblichen »Frau Achtelik« war das eigentlich genau das, was ich mir lange gewünscht hatte. Allerdings habe ich mich in der Zwischenzeit schon so an meinen neuen Vornamen Sasha gewöhnt, dass es mir mittlerweile komisch vorkommt, wenn mich Leute weiterhin Kirsten nennen – obwohl ich mir das erst vor einem Vierteljahr selbst ausgesucht habe. Das ist verwirrend, anstrengend und völlig unerwartet.
Es ging vor der Namensänderung vor allem darum, wie ich wahrgenommen wurde und nicht so sehr darum, wie sich das von innen anfühlt – oder anders: vorher haben mich die Blicke und die Ansprache gestört, jetzt stört mich auch, wie sich mein Körper anfühlt.
Ich würde mittlerweile gerne Testosteron nehmen, vielleicht gar nicht viel, vielleicht nur kurz, aber ausprobieren was passiert, würde ich gerne. Ich möchte nicht »männlich« aussehen, aber gerne weniger »weiblich«. Weniger Brust, weniger Hüfte, ein schmaleres Gesicht, eine tiefere Stimme. Ich kann aber kein Testo nehmen, weil der Scheiß-Tumor nicht nur Rezeptoren für Östrogen, sondern auch welche für Testosteron hatte. Das wird »natürlich« nicht regulär geprüft, aber meine Gynäkologin hat mir für die Laboruntersuchung des archivierten Tumors eine Überweisung geschrieben, tja, Treffer. Ich nehme nun schon seit mehreren Jahren Medikamente, die Östrogen bzw. dessen Kontaktstellen zu den Krebszellen blockieren, mit mehr oder weniger unangenehmen Nebenwirkungen. Wenn ich jetzt Hormone nehmen würde, ohne deren Kontaktstellen blockieren zu können – sowas gibt es für Testo »natürlich« nicht, daran hat nie jemand geforscht, weil davon ausgegangen wird, dass Leute mit Brustkrebs Frauen sind – wäre das wohl eher kein angemessenes Risikoverhalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das niemals machen würde, aber definitiv erstmal nicht.
Erstmal versuche ich andere Dinge: Ich kaufe meine Klamotten in der Männerabteilung, dabei bin ich immer wieder erstaunt, wie langweilig das ist und wie wenig Auswahl es gibt. Ich trage Binder oder tape mir die Brust weg. Ich korrigiere die Leute, die mich als Frau ansprechen. Ich versuche Sport und Krafttraining zu machen und dadurch die »richtigen« Muskeln aufzubauen. Ich stehe auf einer Warteliste für einen Stimmtrainer, der sich mit transmasc Stimmen auskennt. Mittlerweile bitte ich meine Partner*innen, meinen Oberkörper eher zu ignorieren. Mittlerweile denke ich über eine OP nach, um mit einer angleichenden Mastek meine verbleibende Brust auch loszuwerden. Ich hoffe auf ein wenig mehr Euphorie, ich wünschte mir die Veränderungen würden schneller gehen, und bin sehr gespannt, was mein eigensinniger Körper noch in petto hat.
-
1
Bei dem schrecklichen Stand der »Debatte« über trans* Leben muss ich vielleicht an dieser Stelle dazu sagen, dass ich nicht über die Gefahr rede, irgendwas zu bereuen. Das kann klarerweise immer passieren, ist aber wie bei Abtreibungen keineswegs das Riesenproblem, als das Transfeind*innen bzw. Antifeminist*innen es darstellen.