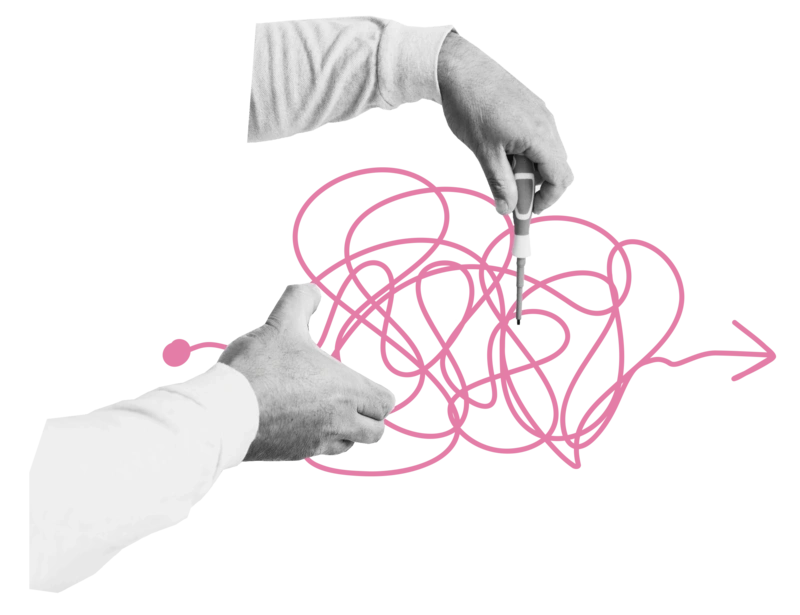
Zukunftsvisionen in Zeiten der Krise
Ein Gespräch über die Ausstellung »Fixing Futures«
Anfang April wurde in Frankfurt die Ausstellung »Fixing Futures: Planetary Futures Between Speculation and Control« eröffnet. Julia Schubert und Steven Gonzalez Monserrate sind Postdocs im Graduiertenkolleg »Fixing Futures: Technologies of Anticipation in Contemporary Societies« der Universität Frankfurt und haben die Ausstellung mitkonzeptualisiert. Im Gespräch geben sie Einblicke in das gemeinsame Nachdenken über offene Zukünfte.
Johanna: Ihr wart beide Teil des Organisationsteams der Ausstellung ›Fixing Futures‘. Könntet ihr uns einen kurzen Einblick geben, worum es bei der Ausstellung geht und wer daran beteiligt ist?
Steven: Die Ausstellung ›Fixing Futures‘ ist im Kern ein Dialog zwischen Wissenschaft, Aktivismus und Kunst über mögliche Zukünfte sowie Auseinandersetzungen mit der Frage, wie wir die Zukunft gestalten können. Dabei werden unterschiedliche Ansätze zusammengebracht: Beim Rundgang durch das Museum trifft man auf Videospuren von Expert:innen aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen, auf vielfältige Kunstwerke, Installationen, Klanglandschaften, interaktive Programme, Videospiele und Filmprojekte. Sie alle beschäftigen sich mit unvermeidbar scheinenden, utopischen oder apokalyptischen Zukunftsvisionen. Die Ausstellung betont dabei die Offenheit der Zukunft, thematisiert aber auch die Dringlichkeit aktueller Krisen wie der Klimakatastrophe.
Julia: Der Untertitel der Ausstellung – »Planetare Zukünfte zwischen Spekulation und Kontrolle« – lenkt den Blick außerdem auf das Spannungsverhältnis zwischen der Darstellung und der Herstellung von Zukünften: Also auf den Zusammenhang zwischen den Mitteln, mit denen Zukunft greifbar, planbar und regierbar gemacht werden soll – etwa durch wissenschaftliche Modelle oder politische Szenarien – und den Effekten, die diese Mittel auf die Realisierung von Zukunft haben. Die Ausstellung regt zur Reflexion darüber an, wie bestimmte Darstellungsformen die Wahrscheinlichkeit künftiger Entwicklungen beeinflussen oder bestimmte Zukünfte überhaupt erst hervorbringen können. Dabei wird ein Zusammenspiel zwischen aktuellem Wissen, möglichen Handlungsperspektiven und ihrer Umsetzung aufgezeigt. Durch interaktive Formate, Führungen und Workshops sollen die Besucher:innen in diesen Reflexionsprozess eingebunden werden.
Johanna: Was zeichnet eurer Meinung nach die unterschiedlichen Zugänge – also die wissenschaftliche, die aktivistische und die künstlerische Perspektive – in Bezug auf die gemeinsame Ausstellung aus?
Julia: Ich denke, der durch die Ausstellung entstehende Austausch zwischen Wissenschaft, Kunst und Aktivismus bietet eine großartige Möglichkeit, dem oft verengten Blick auf die Zukunft eine spekulative, öffnende Perspektive an die Seite zu stellen. Wissenschaft strebt im Umgang mit der Zukunft häufig nach Eindeutigkeit – festem Wissen, klaren Prognosen oder technologischen Lösungen. Die Kunst stellt dagegen eine wichtige Dimension der Spekulation und Öffnung dar. Sie mildert damit auch die Gefahren, die mit einem rein wissenschaftlich-technologischen Zugang zur Zukunft verbunden sein können. Wissenschaft sollte am gesellschaftlichen Dialog teilnehmen, historische Kontinuitäten, politische Pfadabhängigkeiten, aber auch Möglichkeiten des Wandels in den Mittelpunkt stellen. Damit könnte wieder mehr ein emanzipatorischer Zugang zur Zukunft sichtbar gemacht werden.
Steven: Es war sehr spannend, als Wissenschaftler:in gemeinsam mit verschiedenen Akteuren an einem Thema zu arbeiten, das unmittelbar mit unserer Forschung im Graduiertenkolleg »Fixing Futures« verknüpft ist. Das heißt, darüber nachzudenken, wie sich unsere Erkenntnisse und gemeinsamen Anliegen einem breiteren Publikum vermitteln lassen. Besonders interessant war für mich auch die Frage, wie sich komplexe wissenschaftliche Debatten über Zukunft in eine künstlerische oder räumliche Form übersetzen lassen. Wie kann man solche Inhalte in einem Museum inszenieren und Besucher:innen aktiv einbeziehen? Aktivistische Perspektiven dabei zu haben, bedeutet in diesem Zusammenhang auch, die Zukunft als politische Frage zu begreifen – als etwas, das gesellschaftlich verhandelbar und gestaltbar ist. Es geht um Fragen von Macht: Wer entscheidet darüber, wie unsere Zukunft aussieht? Welche Zukünfte gelten als bewahrenswert – und wer bestimmt das? Wem steht es überhaupt zu, über die Zukunft nachzudenken?
Johanna: An diese Fragen anschließend: Welche Visionen oder Vorstellungen von Zukunft werden in der Ausstellung entworfen – womöglich jenseits von bekannten Narrativen?
Steven: Eines der Ziele der Ausstellung ist es, dekoloniale Perspektiven auf die Zukunft in den Mittelpunkt zu rücken. Es gibt beispielsweise einen Ausstellungsteil von Jordan Rita Seruya Awori, in dem mithilfe von künstlicher Intelligenz spekulative Versionen von Städten entworfen werden. Dabei wird versucht, nachzuvollziehen, wie Städte und ihre Geschichte ohne kolonialen Einfluss aussehen würden oder welche Auswirkungen eine andere Kolonialordnung auf das Stadtbild gehabt hätte. Es gibt auch ein spannendes Kunstwerk von Adhavan Sundaramurthy, das in der Form des Tamizh Futurism Architekturen für alternative, postkoloniale Zukünfte entwickelt. Die ausgestellten Plastiken, die mittels 3D-Druck entstanden sind, sind von der Grammatik der tamilischen Sprache inspiriert. Zahlreiche weitere Werke befassen sich mit alternativen Welten und verfolgen das Ziel, die koloniale Ordnung, die wir geerbt haben, aufzuzeigen und infrage zu stellen. Sie regen dazu an, über Zukünfte nachzudenken, die auf anderen Mythologien, Traditionen und Sprachen basieren.
Julia: Durch alternative, dekoloniale Zukunftsvisionen versucht die Ausstellung aufzuzeigen, wie Vergangenheit und Zukunft miteinander verwoben sind – und wie sich bestimmte Kontinuitäten bis in die Gegenwart und mögliche Zukünfte fortschreiben. Zudem geht es viel um eine Auseinandersetzung mit Technologie, die eine handhabbare Zukunft verspricht. Dabei wird deutlich, dass technologische Entwicklungen – wie solche, die als Lösungen für die Klimakrise präsentiert werden – stets gesellschaftlich eingebettet sind und durch politische sowie historische Kontexte geprägt werden. Dies greift die Ausstellung unter anderem durch die kritische Auseinandersetzung mit Geoengineering auf. Dabei handelt es sich um den Versuch, den Klimawandel durch Eingriffe in geophysikalische Prozesse zu beeinflussen. Besonders eindrucksvoll finde ich beispielsweise die Grafikserie ›We will find salvation in strategic chemical spills‘ von Colin Lyons, die künstlerisch und kritisch Vorschläge zur Klimamanipulation wie den planetaren Sonnenschirm oder die Injektion von Schwefelpartikeln in die Stratosphäre thematisiert und deren Pfadabhängigkeiten visualisiert.
Johanna: Das Motto dieser Ausgabe, »No Limits«, verweist auf militärische Aufrüstung, Umweltzerstörung und autoritäre Entwicklungen. Warum ist es angesichts dieser Krisen unserer Zeit dennoch wichtig, die Pluralität der Zukunft zu betonen und an alternative Zukünfte zu denken?
Julia: Die Pluralität bzw. Kontingenz von Zukunft war für uns von Anfang an sehr wichtig. Gerade angesichts einer Welt, die von multiplen Krisen geprägt ist, erscheint es mir entscheidend, die Kontingenz von Zukunft und damit die Möglichkeit der Veränderung zu betonen. »Plural« bedeutet, dass es nicht den einen Lösungsweg gibt, keinen objektiven, global gültigen Pfad zur Bewältigung dieser Krisen. Vielmehr wird es um die gesellschaftliche Aushandlung unterschiedlicher Perspektiven und fundamentaler Interessenskonflikte gehen, die ganz unterschiedlich aussehen kann. Wir sollten diese Pluralität möglicher Zukünfte in den Mittelpunkt stellen, statt darauf zu beharren, dass die alteingesessenen Wege die richtigen sind. Natürlich leben wir mit der Klimakrise in einer Zeit, in der man unter anderen Bedingungen über die Zukunft nachdenken muss, da materielle und klimatische Realitäten unseren Handlungsspielraum anders begrenzen. Es ist wichtig, auf diese Verhältnisse und Einschränkungen hinzuweisen, ohne sich in Unvermeidbarkeit zu verlieren. Es braucht auch positive Visionen für die Frage: Wie wollen und können wir in Zukunft zusammenleben?
Steven: Ich glaube, mit der Ausstellung reagieren wir auch auf eine verbreitete Ohnmacht und Resignation, die wir in akademischen Kreisen wahrnehmen. Oft dominiert die Vorstellung, dass krisenhafte Entwicklungen unveränderlich seien und uns alle gleichermaßen treffen würden. Natürlich möchte ich gerade die Schwere der Klimakatastrophe nicht herunterspielen – die Bedrohung ist real und erschreckend. Aber diese fatalistische Sicht auf die Zukunft ist zugleich begrenzt. Sie geht davon aus, dass bestehende Politiken und Systeme in den nächsten Jahren genauso fortbestehen und übersieht oft, dass Krisen eben nicht alle gleichermaßen betreffen. Für viele indigene und kolonisierte Gemeinschaften etwa sind apokalyptische Erfahrungen längst Realität. Die Geschichte zeigt aber auch, dass Menschen immer wieder aus katastrophalen Zuständen heraus neue gesellschaftliche Verhältnisse schaffen konnten. Genau deshalb ist es heute so wichtig, sich radikal für neue, alternative Zukunftsvorstellungen zu öffnen – und dabei möglichst viele Stimmen und Menschen einzubeziehen. Gerade soziale Bewegungen und Aktivist:innen arbeiten oft auf gerechtere Zukünfte hin und solche Visionen einer besseren Welt können viel Antrieb und Kraft für konkrete Veränderungen geben.
Johanna: Was gibt euch Anlass zur Hoffnung, wenn ihr an die Zukunft denkt?
Steven: Ich glaube, wenn man genau hinsieht und danach sucht, gibt es trotz allem Grund zur Hoffnung. So sehr sich die politischen Bedingungen weltweit verschärfen, beispielsweise durch Einschränkungen von Rechten und Freiheiten, so sehr beobachten wir zugleich ein politisches Erwachen, eine neue Form von Solidarität und ein globales Streben nach Befreiung, das über Grenzen hinweg sichtbar wird. Als Science-Fiction-Autor muss ich auch Hoffnung sehen, denn beim Schreiben über die Zukunft kann es nicht nur darum gehen, einen Zusammenbruch zu modellieren. Es geht auch darum, dominanten Zukunftserzählungen etwas entgegenzusetzen: alternative Möglichkeiten sichtbar zu machen und die Grundlagen unserer Weltordnung zu hinterfragen. Und ich glaube, dass aus diesem kritischen Hinterfragen eine gerechtere Welt entstehen kann, die mehr Wohlstand für alle enthält.
Julia: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Derzeit werden viele Konflikte und Fragen sichtbar, die zwar schon vorher vorhanden waren, im politischen Alltag jedoch oft untergegangen sind. Trotz aller Krisen und Frustration gibt es, denke ich, auch einen Silberstreif am Horizont: Bestimmte Fragen, die lange als beantwortet galten, werden wieder neu gestellt. Es findet eine Politisierung statt. Daraus kann womöglich etwas Neues entstehen, und das gibt mir Hoffnung.