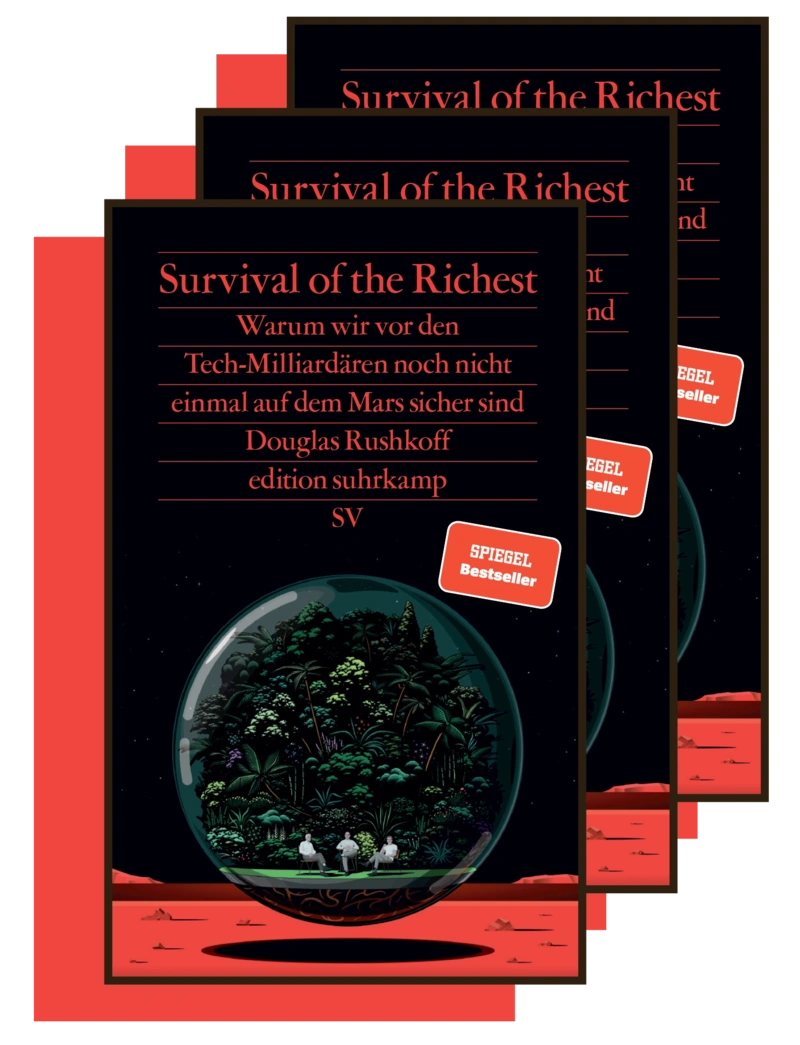
»Survival of the Richest«
Rezension des Buches von Douglas Roushkoff
Im Februar 2025 kündigte Donald Trump an, die USA würde den Gaza-Streifen übernehmen, genauer gesagt, kaufen, um dort die »Riviera des Nahen Ostens« aufzubauen. Die dort lebenden Palästinenser*innen sollten das Land verlassen und stattdessen »in andere interessante Länder« gehen. Trump malt die Vision, auf dem vom Krieg zerstörten und von den dort lebenden Palästinenser*innen gesäuberten Gebiet eine amerikanische Ferienlandschafts-Utopie bzw. Dystopie aufzubauen: Eine neue Welt erbauen auf den Trümmern, die Wohlstand verheißen soll – aber ohne die Menschen und Gemeinschaften die dort »ein elendes Leben gelebt haben«.Eine »Mindset«- Lösung für Palästina oder »Gottspiele« könnte man das im Sinne von Douglas Rushkoff auch nennen.
In dessen neuem Buch »Survival of the Richest. Warum wir vor den Tech-Milliardären nicht einmal auf dem Mars sicher sind« (Engl: »Survival of the Richest. Escape Fantasies of the Tech-Billionaires«, 2022) beschäftigt sich der Autor mit den größenwahnsinnigen Utopien der Superreichen und versucht die verschiedenen Elemente der dahinterstehenden Ideologie, die er als »das Mindset« bezeichnet, auszudifferenzieren. Eines dieser Elemente des »Mindsets«: Die antizipierte Zerstörung – egal ob durch Klimakatastrophe, Atombombe, Apokalypse oder Krieg wird als Chance gesehen, um »von Null anzufangen« und damit Gewinn zu machen – ohne Rücksicht auf diejenigen, die zurückgelassen oder ermordet werden. Wie viele Zukunftsvisionen, die auf dem »Mindset« beruhen, basiert Trumps Fantasie von »Trump-Gaza« auf der Zerstörung der Gemeinschaft und der natürlichen Umgebung, das heißt in diesem Fall darauf, dass, Zivilist*innen bombardiert und getötet werden, mehrfach zwangsumgesiedelt wurden, ausgehungert werden und wurden, und dass zivile Infrastruktur gezielt angegriffen wird, darunter Krankenhäuser und die Wasserversorgung. Somit kann »Trump-Gaza« als ein Beispiel für die von Rushkoff beschriebene »Mindset« betrachtet werden. Anhand von anderen Beispielen im Buch zeigt Rushkoff, dass die Zerstörung der Gemeinschaft und der Umwelt nicht nur eine Chance für Tech-Milliardäre ist, sie sind die Voraussetzung dafür, »sich über die zurückbleibenden zu erheben« und private Projekte basierend auf radikaler Marktlogik, ohne rechtliche und demokratische Einschränkungen aufzubauen. Gleichzeitig präsentieren sich die Milliardäre als Rettung oder auch Lösung für Probleme, die sie selbst mit produziert haben.
Survival of the Richest
Das 2025 bei Suhrkamp erschienene Buch dekonstruiert auf rund 360 Seiten anhand verschiedener Beispiele das, was der Autor als »Mindset« bezeichnet: Die (Wahn-) Vorstellung der Tech-Milliardäre, sie könnten mit genug Geld und der richtigen Technologie die Gesetze der Physik, der Wirtschaft und der Moral brechen, um einer Katastrophe zu entgehen, die sie selbst verursacht haben – und dabei alle anderen hinter sich lassen. Sei es in einem Bunker, auf dem Mars, auf schwimmenden Privatstädten oder im digitalen Metaverse. Dabei haben sie kein Interesse daran, »das Ereignis« – wie sie die antizipierte Katastrophe nennen — zu verhindern. Sie möchten nur vor den Folgen des eigenen Handelns fliehen. Und es wäre eben nicht das »Mindset«, wenn sie dabei nicht noch wirtschaftlichen Gewinn machen könnten: Daher ist eines der zentralen Elemente die Idee, sie seien die Berufenen für den Aufbau einer neuen Welt, die ganz unabhängig von der alten, zerstörten Welt und den dort lebenden Menschen funktioniert, weshalb unbedingt in sie und ihre Unternehmen investiert werden müsse.
Douglas Rushkoff, der Autor des Buches, ist Professor für Medientheorie und digitale Wirtschaft am Queens College der City University New York. Er schreibt seit Ende der 1980er Jahre als marxistischer Medientheoretiker über »das Internet«. Dabei nahm er schon früh eine kritische Perspektive auf die Internetrevolution und ihre Kapitalisierung ein und gilt heute als führende Stimme für den Einsatz digitaler Medien für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit.
Spätestens seit seiner Zeit im College in den 1960ern bewegte Rushkoff sich in der Bubble, die man ab den 1980er Jahren wohl als »Cyberpunks« bezeichnete: Eine Mischung aus Hacker*innen, Künstler*innen und »paranoiden Ravern«, die mit psychedelischen Drogen experimentierten. Sie brachen damals mit der Überzeugung ins Silicon Valley auf, dass das damals tatsächliche Neuland Internet das neue kollektive Projekt der Menschheit werden würde: Ein Ort ohne Eigentum. Man sah die Möglichkeit eine »neue Realität zu programmieren« und zwar kommunitaristisch und unreguliert vom Staat. Sie galten als Vorreiter*innen, die einzigen die wirklich ahnten, wie sehr wie sehr digitale Technologie das menschliche Zusammenleben verändern würde. Wenn auch anders als einige damals vielleicht hofften. Sie wollten die Welt verändern – und wurden vom Kapital geschluckt, so Rushkoff. Diese vom Kapital geschulten Cyberpunks bilden in Rushkoffs Buch den Ausgangspunkt der verschiedenen Ausdrucksformen des »Mindset« der heutigen superreichen Tech-Milliardäre.
Superreiche Prepper
Rushkoff versucht also die Einstellung, das »Mindset« der heutigen Tech-Milliardäre, nachzuvollziehen und zu dekonstruieren. Dabei sind zwei Aspekte natürlich zentral: Technologie und Kapitalismus. Nach der Lektüre des Buches würde man sagen: Eine gefährliche Kombination.
»Jene, die es mit fragwürdigen Methoden an die Spitze geschafft haben, wollen nicht zurückblicken und sehen, welche Verwüstung sie hinterlassen haben. Sie brauchen eine Exit-Strategie und ziehen es möglicherweise vor, sich eine Zukunft auszumalen, in der sie gezwungen sind, sich von denen abzuschotten, die sie ausgebeutet haben. So müssen sie sich nicht schuldig fühlen, schämen oder vor Rache fürchten«
Den Ursprung von Rushkoffs Buch bildet die Erfahrung, dass er von Tech-Milliardären angefragt wurde, sie zu beraten, wie sie es nach Eintritt »des Ereignisses« schaffen könnten, dass die Sicherheitsangestellten ihrer Bunker sich nicht gegen sie wenden würden. Es war wohl ziemlich bizarr, aber Rushkoff wurde neugierig und tauchte in die Lebensrealität von sehr reichen Preppern ein, die sich, in unterschiedlicher Weise, auf eine mögliche Katastrophe vorbereiten wollten: Private Bunker, autonome Farmen oder ganze schwimmende Privatstädte (»Seasteading«): Gemeinsam ist laut Rushkoff diesen Ansätzen, dass sie im Kern auf Abschottung setzen, jede Form der Gemeinschaftlichkeit ablehnen, nach maximaler individueller Souveränität streben und in ihren Zukunftsvisionen auf einen radikal freien Markt setzen. Das Seasteading Institute geht noch weiter und träumt vom Experimentieren »mit vielfältigen innovativen gesellschaftlichen, politischen Rechtssystemen«.
Digitale Technologien und Abschottung
Doch Rushkoff ist überzeugt, dass die superreichen Prepper, die er trifft, vor der Realität und den Folgen ihres Handels nicht werden fliehen können. Die Vorstellung, man könnte die Welt da draußen einfach ausblenden und ignorieren, bringt er mit der digitalen Technologie selbst in Verbindung: Was, wenn das Mindset nicht nur vom Kapitalismus, sondern vorrangig von der Technologie selbst hervorgebracht wird? Digitale Technologien vermitteln, laut Rushkoff, dass man die Zerstörung, das Leid und die Einsamkeit ignorieren könnte – insbesondere dann, wenn die Zerstörung der realen Welt voranschreitet: »Da die Ressourcen schrumpfen und die wirtschaftlichen Bedingungen schlechter werden, sollen technologische Simulationen die realen Wohlstandseinbußen wettmachen«.
Darüber hinaus hätten digitale Technologien im Kapitalismus häufig das das Ziel die Realität der Arbeitsbedingungen, die Ausbeutung von Arbeiter*innen und Umwelt vor den Konsument*innen zu verbergen. Bei der Produktion von Smartphones beispielsweise müssten Arbeiter*innen im letzten Schritt vor dem Verpacken, mit einer Chemikalie alle Fingerabdrücke von den Geräten entfernen, um jede Spur der menschlichen Beteiligung und jede Erinnerung an die Produktionsbedingungen zu beseitigen. Eine Chemikalie, die zu Fehlgeburten und Krebs führt.
Das Ziel im Sinne des »Mindset« ist nach Rushkoffs Erzählungen eine technologisierte Gesellschaft, die Abschottung, sowie Verleugnung und Ignoranz von Umweltzerstörung, Ausbeutung oder auch Kriegen dauerhaft ermöglicht.
Meta gehen
»Alles besteht aus Daten, alles hat einen Preis, alles kann vermehrt werden.«
Ein weiterer Aspekt im Mindset der Tech-Milliardäre ist laut dem Autor die Affirmation einer szientistischen Einstellung. Diese gehe einher mit der Reduzierung des Menschen und der Natur auf organische Materie, die sich in seiner Gänze in Algorithmen erfassen lasse. Gefühle, Intuition und Moral werden dabei nicht als relevant oder »wirklich« anerkannt. Die Vertreter*innen halten sich für rational, neutral und objektiv — oder wollen sich so darstellen — obwohl sie an einem unausgesprochenen Wertesystem festhalten.
Mit einem solchen Verständnis von Wissenschaft, das diese »aus dem Kontext von Sinnhaftigkeit und Moralität [herauslöst], wird es leicht sie in den Dienst von Beherrschung und Kontrolle zu stellen und für die Rechtfertigung der Entfremdung durch das Mindset zu missbrauchen«.
Denn, die Vorstellung, das alles Menschliche und Natürliche in Algorithmen übersetzt und in eine Cloud übertragen werden kann, bilde die Grundlage für technologische Zukunfts- und Fluchtvorstellungen, die Einzelpersonen oder ganze (exklusive) Gemeinschaften in eine digitale Parallelwelt übertragen, um damit vermeintlich den Problemen der realen Welt zu entkommen – oder sie möglichst ignorieren und ausschließen zu können. »Meta gehen« nennt Douglas Rushkoff das in seinem Buch: Anstatt Probleme zu lösen, fordere das »Mindset«, sich auf die nächste Ebene zu erheben, z.B in die digitale Welt. Das dahinterliegende Prinzip bringt Rushkoff jedoch sinnvollerweise mit den Entwicklungen des historischen Kapitalismus und dessen expansiven Logik in Verbindung. Sowohl den europäischen Kolonialismus als auch die Entwicklungen des Finanzmarktes, sowie die Entwicklung von Kryptowährungen analysiert er (wenn auch kurz gehalten) als Formen der kapitalistischen Landnahme. Die Digitalisierung, so Rushkoff, biete das Versprechen der unendlichen Möglichkeit der Expansion, indem man einfach eine Stufe »meta« geht, wenn ein Markt ausgeschöpft, oder natürlichen Grenzen ausgesetzt ist.
Fortschrittsideologie meets psychedelische Drogen
Die Rolle der psychedelischen Kultur in der technokratischen Elite, die Rushkoff bereits in den Anfängen des Silicon Valley beobachtete, spielt dabei auch heute noch eine Rolle. Rushkoff berichtet eindrücklich und unterhaltsam von Tech-Festivals und Konferenzen, auf denen psychedelische Drogen konsumiert wurden, um der vermögenden Elite Heils- und Erleuchtungserfahrungen zu ermöglichen. Es geht darum, sich auf eine neue Bewusstseinseben zu begeben mit dem Ziel durch die »Kraft des exponentiellen Denkens« die »Welt zu retten«. Die kapitalistische Ideologie des Fortschritts findet er hier in narzisstisch-esoterischer Form wieder. So glauben die vermögenden innovativen und visionären Denker*innen, sie seien die Auserwählten, die als einzige mithilfe von psychedelischen Drogen den nächsten Sprung in der Evolution machen, und damit die Welt retten könnten. Der Organisator des »Further Future Festival« erklärt: »(…) Dies sind nicht einfach Leute, die das tun können, sondern dies sind die einzigen Leute, die es tun können«. Bemerkenswert für Rushkoff ist dabei einerseits der disruptive Sprung, in dem diese Weltveränderung gedacht wird, andererseits das fehlende Interesse an der Arbeit mit bestehenden Projekten, Gemeinschaften und Initiativen. Es wird von Neuanfang, Umwälzung und Gottspielen geträumt. »ReGen Villages« beispielsweise sollen eine umfassende technologische Lösung für den Aufbau regenerativer und widerstandfähiger Gemeinschaften mit Kreislaufwirtschaft, Wasserversorgung, eigenem Lebensmittelanbau und Ausbildungsstrukturen anbieten, in Form von Apps und Programmen, die eine selbstständige Verwaltung dieser Systeme ermöglichen. Der Traum einer jeden Ökosozialistin könnte man meinen. Aber: »Anstatt einer vorhandenen Gemeinde dabei zu helfen, ein regeneratives System zu errichten, muss das ReGen-Projekt auf unberührtem Gebiet, aus dem Nichts entwickelt werden«. Die Vorstellung vom »unberührten Gebiet« lässt sich über Rushkoff hinausgehend als inhärent koloniale kritisieren. Also doch eher ein Traum für »Trump-Gaza«?
Widerstand?
»Algorithmen sind immer nur so neutral, wie die Menschen, von denen sie programmiert werden.«
Entsprechend seiner persönlichen Nähe zur Tech-Bubble bleibt ein affirmativer Aspekt in Bezug auf die Nutzung von technischen Entwicklungen für die Lösung gesellschaftlicher Probleme in Rushkoffs Buch bestehen. Widerständige Potenziale findet er in Momenten und Bewegungen, die sich die digitale Struktur selbst zunutze machen: Beispielsweise eine Gruppe von Reddit-User*innenn, die sich organsierten, um den beliebten Videospielhändler GameStop zu retten, indem sie Aktien kauften, und den Wert in die Höhe trieben. Die Aktion richtete sich gegen Hedgefonds, die auf den Untergang von Unternehmen wetteten. Zentral war für Rushkoff jedoch, dass sie es aus Spaß taten, als Streich, und damit die Logik des Aktienmarktes untergruben. Rushkoff scheint recht optimistisch, wenn er erklärt, dass »Technologien, die vor allem entwickelt wurden, um Menschen zu kontrollieren«, genutzt werden können, um Chaos zu stiften – und um Widerstand zu leisten?
Wie so oft erscheinen die Vorschläge zum Widerstand und Veränderung nach der ausgiebigen Beschreibung des Problems allerdings etwas hilflos, oder auch nicht radikal genug. Doch er fordert, dem »Mindset« eine Gegenkultur entgegenzusetzen, die auf Zirkularität, statt linearen Fortschritt basiert und die vor allem die Überzeugung hochhält, dass »das Ereignis« nicht unvermeidlich ist, dass wir noch eine Wahl haben. Denn die Akzeptanz der Katastrophe bildet die Grundlage des »Mindsets«. Das zeigt sich nicht nur bei Rushkoffs Beispiel des Seasteading Institutes, das auf den ansteigenden Meeresspiegel und die Unbewohnbarkeit von ganzen Landstrichen baut. Auch hier stellt »Trump-Gaza« wieder ein weiteres gutes Beispiel dar, da es die Vertreibung oder sogar Auslöschung der Palästinenser*innen als Grundlage nicht nur akzeptieren, sondern voraussetzten würde.
Elemente des »Mindset«
»Noch jede Gemeinschaft, die ein vergleichbares Maß an wirtschaftlicher Ungleichheit hatte, rutschte in den Faschismus. Noch nie ist eine Zivilisation, die ihre physische Umwelt derart ausgebeutet hat, dem Zusammenbruch entgangen. Können wir Lehren aus diesen Mustern ziehen und dasselbe Schicksal vermeiden?«
Während man das Buch liest, folgt ein »WTF«- Moment dem nächsten. Geschickt nutzt Rushkoff Erzählungen von seinen Erlebnissen aus der Zeit als er sich noch als »Bürger des Cyberspace« bezeichnete, sowie aus aktuellen Gesprächen und Konferenzen mit Tech-Milliardären und solchen die es werden wollen. Diese führen den Lesenden die Absurdität solcher Pläne und Denkweisen unterhaltsam vor Augen. Doch die Anekdoten sind eben auch Ausgangspunkte von denen aus er die verschiedenen Ausprägungen des »Mindsets« sowie die darunter liegenden Überzeugungen, Ziele und Ängste dekonstruiert und herrschaftskritisch analysiert. Dabei könnte die Verbindung zwischen der kapitalistischen Ideologie und dem »Mindset« noch deutlicher gemacht werden. Denn, diese Überzeugungen sind Effekte von Isolation und Entfremdung, von Fortschritts- und Leistungsideologie und der Konkurrenz und Selektion. Und diese betreffen eben nicht nur Tech-Milliardäre, sondern prägen alle Teile unserer Gesellschaft. Die Beobachtungen von Rushkoff könnten noch deutlicher als extreme Form und Folge des technologischen Kapitalismus benannt werden.
Der Autor wirkt in seinen Berichten selbst gleichsam fasziniert und abgestoßen. Er scheint selbst nicht sicher zu sein, ob man die Pläne der Milliardäre wirklich ernst nehmen kann — nicht zuletzt, weil sie so oft scheitern: Trump-Gaza ist vier Monate später schon aus der öffentlichen Debatte verschwunden, Zuckerbergs Metaverse Projekt gilt als gescheitert. Aber auch, weil die Vorstellung sich so umfassend von der »Realität« abschotten zu können von natürlichen und technischen Grenzen geprägt sei, sodass diese Vorstellung einfach nicht auf gehe: »Der Bunker des Milliardärs ist weniger Ausdruck einer Strategie für die Apokalypse als eine Metapher für diese realitätsferne Einstellung zum Leben«. Was das »Mindset« jedoch nicht weniger gefährlich macht.
Rushkoff arbeitet die Grundlage dafür heraus, zu verstehen, dass die dahinter stehenden Überzeugungen trotzdem ernst zu nehmen sind. Denn die Absurdität der Pläne wird die Tech-Milliardäre nicht davon abhalten diese um jeden Preis zu verfolgen, solange sie das Geld dafür haben und uns dabei alle mit in den heiß ersehnten Abgrund ziehen. Damit sie endlich Gott spielen können, wenn alles zerstört ist.
Das Buch von Rushkoff zeigt also, dass die meist wahnsinnig erscheinenden Visionen Superreicher nicht als Einzelfälle abgetan werden, sondern als das Ergebnis einer Ideologie, die dem technologischen Kapitalismus entspringt, ernstgenommen werden sollten. Das gilt auch über die im Buch genannten Beispiele hinaus. Auch in der Idee von »Trump-Gaza« steckt die Überzeugung, wonach das, was aktuell in Palästina passiert, und von Beobachter*innen und Völkerrechtler*innen international nicht ohne Begründung als Genozid, also Völkermord, bezeichnet wird (u.a. Amnesty International 20241), für Vertreter*innen des »Mindset« nicht nur eine Chance, sondern die Grundlage dafür ist, ihre Fantasien einer neuen Welt umzusetzen und dabei die Zerstörung von Gemeinschaften und der natürlichen Umwelt dankend in Kauf zu nehmen.
-
1
Amnesty International (2024): You Feel Like You Are Subhuman‹: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza. Amnesty International Ltd, London: https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-12/Amnesty-Bericht-Gaza-Genozid-Voelkermord-Palaestinenser-innen-Israel-Dezember-2024.pdf