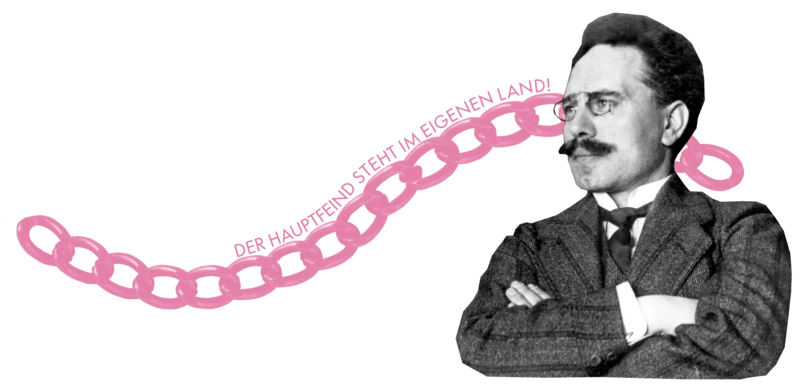
Die Neuformierung der imperialistischen Kette in der großen Krise des Kapitalismus
Handelskonflikte, Kriege, Faschisierungstendenzen: Die globale Ordnung ist im Umbruch begriffen und die imperialistische Kette formiert sich neu.
Die kapitalistische Staatenwelt ist durch wachsende soziale Ungleichheit im nationalen und internationalen Maßstab, die Zuspitzung des ökologischen Desasters, eine zunehmende Zahl von Kriegen und viele andere Krisenmomente geprägt. Insgesamt kann man angesichts der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 bis 2009, der Covid-19-Pandemie, der Kriege in der Ukraine, in Westasien, im Sudan und andernorts, angesichts der Teuerungswelle und der politischen Krisen in vielen Ländern von einer großen Krise sprechen — »groß« in dem Sinne, dass sie nicht wie »kleine« zyklische Krisen durch die »Selbstheilungskräfte« der kapitalistischen Produktionsweise, also durch Vernichtung der weniger profitablen Kapitale und kleinere Anpassungsprozesse im Rahmen der existierenden Entwicklungsweise des Kapitalismus überwunden werden kann. Die Reproduktion der kapitalistischen Produktionsverhältnisse erfordert vielmehr einen tiefgreifenden Umbau der Gesellschaftsformationen. Es handelt sich eben nicht nur um eine ökonomische Krise, sondern um eine organische Krise (Antonio Gramsci), die alle Instanzen der Gesellschaftsformationen erfasst. Alte Bindungen zwischen Repräsentanten und Repräsentierten lösen sich auf, alte politische Parteien verlieren an Bedeutung und neue entstehen; es ist die Stunde der neuen, mehr oder weniger charismatischen Führer, die Sicherheit und Wohlstand in einer Welt zunehmender Unsicherheit und Verelendung versprechen.
Innerhalb der herrschenden Klassen gibt es keine Einigkeit, wie die Krise zu bewältigen wäre. Vielmehr konkurrieren verschiedene Ideologien mit je eigenen Auffassungen der Probleme, ihrer Ursachen und der möglichen Lösungen miteinander. Beispielsweise stehen Projekten eines »grünen« Kapitalismus Projekte eines radikalisierten Konservatismus oder eines neuen Faschismus gegenüber. Ein Aspekt der Krise, auf den ich mich im folgenden konzentriere, besteht in der verschärften Weltmarktkonkurrenz und den veränderten Mitteln, mit denen der Kampf um die Positionen in der hierarchischen internationalen Arbeitsteilung ausgetragen wird.
Die neoliberale Globalisierung und der Aufstieg Chinas
In der Ära der neoliberalen Globalisierung wurden immer größere Teile der Produktion von den alten kapitalistischen Zentren in Staaten der (Semi-)Peripherie verlagert, um dem Fall der Profitraten entgegenzuwirken. Insbesondere China war ein attraktives Ziel von Kapitalexporten, weil dort einerseits eine hohe Ausbeutung von Arbeiter*innen auf der Basis von vergleichsweise niedrigen Löhnen, langen Arbeitszeiten und hohen Produktivitätszuwächsen realisiert werden konnte und andererseits ein schnell wachsender Binnenmarkt hohe Umsätze versprach. Hohe staatliche Investitionen in die Infrastruktur spielten dabei eine wesentliche Rolle. Sie waren nur möglich, weil sich durch die antikoloniale und antifeudale Revolution seit 1949 eine Entwicklungsdiktatur mit hoher staatlicher Steuerungskapazität herausgebildet hatte, die die Volksrepublik China von den meisten anderen (semi-)peripheren Staaten unterscheidet.
China ist allerdings längst nicht mehr nur eine »verlängerte Werkbank« der Konzerne aus den alten kapitalistischen Zentren. Chinesische Unternehmen sind zu einer ernsthaften Konkurrenz herangewachsen. In einer Reihe von Hightech-Bereichen und neuen Branchen sind chinesische Unternehmen bereits Weltmarktführer. Dies betrifft beispielsweise die Mobilfunktechnologien der 5. und 6. Generation, Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die Batterietechnologie, die Produktion von Elektroautos, Windkraft- und Solaranlagen. Die staatliche Industriepolitik hat sich ausgezahlt. Für Elektroautos oder für die massenhafte Anwendung neuer digitaler Technologien ist China neben den USA zum Leitmarkt geworden. China ist, kurz gesagt, von der Peripherie der Weltwirtschaft ins Zentrum aufgerückt.
Inzwischen macht sich die Überakkumulation von Kapital auch in China immer stärker bemerkbar. Der enorme kreditfinanzierte Bauboom hat zu einer Immobilienkrise geführt. Würden die Banken nicht vom Staat gestützt, so wären viele unter der Last ihrer faulen Kredite bereits zusammengebrochen. In zahlreichen Industrien gibt es enorme Überkapazitäten. So werden beispielsweise von den mehr als hundert Unternehmen, die in die Produktion von Elektroautos eingestiegen sind, wahrscheinlich nur einige wenige überleben. Während China in den vergangenen Jahrzehnten als Rettungsanker für die von der Überakkumulation in den alten kapitalistischen Zentren geplagten Konzerne fungierte, kann es diese Rolle zukünftig immer weniger spielen, je mehr auch dort die kapitalistischen Krisentendenzen zur Geltung kommen. Das chinesische Kapital sucht inzwischen selbst nach neuen profitablen Anlagesphären im Ausland; arbeitsintensive Produktion wird aufgrund sinkender Profitraten von China nach Vietnam und in andere Länder Südostasiens verlagert. China ist selbst zu einem der größten internationalen Kapitalexporteure geworden.
Die Strategien der alten kapitalistischen Zentren
Die Uneinigkeit unter den Herrschenden in den alten kapitalistischen Zentren berührt auch die Frage, wie auf die Umbrüche in der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung und insbesondere auf den Aufstieg Chinas reagiert werden sollte. Die USA kämpfen mit verschiedenen Mitteln um die Aufrechterhaltung ihrer weltweiten Dominanz. Ihre Regierungen haben seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 bis 2009 immer stärker Strategien verfolgt, die darauf abzielten, den weiteren Aufstieg Chinas zu blockieren und den wachsenden internationalen Einfluss der Volksrepublik einzudämmen. Die Obama-Administration trieb die militärische Einkreisung Chinas voran und beschloss, das US-amerikanische Militär stärker in der indopazifischen Region zu konzentrieren (»Pivot to Asia«). Die erste Trump-Administration entfesselte einen Handelskrieg gegen China, bei dem die Zollpolitik allerdings primär als Instrument genutzt wurde, um bessere »Deals« mit dem Rivalen zu erreichen. Sie zielte weniger auf eine Abkopplung der US-Wirtschaft von China als vielmehr auf einen besseren Zugang der US-Konzerne zum chinesischen Markt und auf den Schutz ihres »geistigen Eigentums«. Präsident Joe Biden setzte die Politik seiner Vorgänger im Grunde fort und schränkte vor allem den Export von US-amerikanischen Mikrochips und anderen Hightech-Produkten nach China weiter ein, um den Aufholprozess des Landes im Hightech-Bereich zu blockieren. Zudem erhob er Zölle auf chinesische E-Autos und Batterien und nutzte industriepolitische Mittel wie den Inflation Reduction Act und den CHIPS and Science Act, um die Produktion strategisch wichtiger Branchen in den USA zu stärken.
Die neue Trump-Administration setzt einerseits die Politik der Vorgängerregierungen gegenüber China fort und nutzt andererseits eine verschärfte Zollpolitik, um die bilateralen Beziehungen mit einer Vielzahl von Staaten neu auszuhandeln. Neben differenzierten Zöllen für bestimmte Branchen und Waren wichtiger Handelspartner wie China, Mexiko und Kanada verkündete Trump pauschale Zölle in Höhe von 10 Prozent auf alle importierten Waren und sogenannte »reziproke« Zölle, mit denen die US-Zölle gegenüber 57 Ländern auf das Niveau der Zölle angehoben werden sollen, die jene Länder (angeblich) gegenüber US-amerikanischen Waren erheben. Kurz nach ihrer Ankündigung am 2. April, dem von Trump proklamierten »Liberation Day«, wurden die »reziproken« Zölle zunächst für 90 Tage wieder ausgesetzt. In dieser Periode soll über die jeweiligen bilateralen Beziehungen verhandelt werden. Die US-Administration setzt dabei darauf, dass die anderen Staaten auf den Zugang zum US-amerikanischen Markt angewiesen und erpressbar sind. Obwohl viele Zölle kurz nach ihrer Ankündigung zunächst ausgesetzt wurden, stieg das durchschnittliche Niveau der Zölle auf importierte Waren in den USA seit Jahresbeginn von 2,5 Prozent auf 17,8 Prozent – der höchste Wert seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre.
Die verkündeten Ziele der Zollpolitik sind widersprüchlich: Einerseits will die US-Regierung über die Zölle Einnahmen generieren und Spielraum für Steuersenkungen gewinnen; andererseits soll die einheimische Produktion gestärkt werden, indem die ausländische Konkurrenz abgewehrt wird bzw. indem Konzerne aus anderen Ländern dazu gedrängt werden, in den USA zu produzieren. Sowohl die Staatsverschuldung als auch das Außenhandelsbilanzdefizit der USA sollen durch die Zölle reduziert werden. Die Strategie ist riskant und Trump hat mit seinen Zollankündigungen am 2. April einen regelrechten Börsencrash ausgelöst. Es drohen höhere Inflationsraten, und Trump setzt damit die Zustimmung zu seiner Regierung aufs Spiel. Ein Dutzend Bundesstaaten haben bereits gegen Trumps Zolldekrete geklagt, da eigentlich nur der Kongress das Recht hat, Zölle zu erheben. Gegenwärtig ist offen, wie der Kampf um die US-Außenwirtschaftspolitik ausgehen wird und welche Effekte dies auf die Weltwirtschaft und die internationale Arbeitsteilung haben wird.
Die deutschen Wirtschaftsverbände und die Bundesregierung verfolgen die Strategie, sowohl mit den USA als auch mit China im Geschäft zu bleiben. Allerdings haben die transatlantischen Kapitalverflechtungen ein höheres Gewicht, und hier besteht eine asymmetrische Abhängigkeit Deutschlands vom US-Kapital. Deswegen gibt es in der deutschen Politik auch die Neigung, sich der US-Politik unterzuordnen. Ähnliches gilt für die anderen EU-Staaten. Die EU schwankt insgesamt zwischen der Unterordnung unter die USA und Versuchen, ihre »strategische Autonomie« zu erhöhen. Entsprechend ambivalent sind auch die gegenwärtigen Aufrüstungsbemühungen Deutschlands und anderer EU-Staaten. Ob sie als Beitrag zur Stärkung der NATO oder zur längerfristigen Schaffung einer von dieser unabhängigen Militärmacht fungieren, muss im Einzelnen analysiert werden. US-Regierungen fordern seit langem, dass ihre europäischen Verbündeten die Militärausgaben erhöhen und mehr »Verantwortung« übernehmen sollen. Dies würde die USA in Europa, Westasien und Afrika militärisch entlasten und es ihnen ermöglichen, sich auf ihren Hauptrivalen China zu konzentrieren. Die Bemühungen der Herrschenden in Deutschland und anderen EU-Staaten um eigenständige europäische Raumfahrtkapazitäten, Satellitensysteme etc. zielen aber auch darauf, sicherheitspolitisch unabhängiger von den USA zu werden.
China wird in Deutschland und der EU als »Partner, Wettbewerber und Systemrivale« bezeichnet – dies ist Ausdruck der widersprüchlichen Interessen der Herrschenden in Bezug auf China. Ähnlich wie die US-Regierung streben sie einen besseren Marktzugang in China an; gleichzeitig versuchen sie, ihre Rohstoffversorgung sowie die Zielländer ihrer Waren- und Kapitalexporte zu diversifizieren und die EU gegen chinesische Direktinvestitionen in strategisch wichtigen Bereichen abzuschirmen. Es geht also nicht um eine generelle Entkopplung von China, aber sehr wohl um eine selektive (»de-risking«).
Widersprüche der imperialistischen Kette erkennen und nutzen
Die veränderte Außenwirtschafts- und Militärpolitik des Westens hat den Aufstieg Chinas bisher nicht stoppen können. Nur in wenigen Hightech-Bereichen ist China noch nicht in der Lage, Importe westlicher Waren durch eigene Produkte zu ersetzen – dies betrifft beispielsweise die avanciertesten Maschinen zur Produktion von Mikrochips. Die Eindämmungspolitik des Westens hat China mit einer Reihe von außenpolitischen Initiativen gekontert. Dazu zählen die Schaffung der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der BRICS-Gruppe und das Projekt der Neuen Seidenstraßen, ein Ensemble von gigantischen Infrastrukturprojekten, um die weltweiten Handelswege auszubauen. Die Volksrepublik schafft damit nicht nur neue Anlagemöglichkeiten für chinesisches Kapital, sie unterminiert auch die bisher von den alten kapitalistischen Zentren dominierte Weltordnung und ihre Institutionen.
Zwischen China als neuem Zentrum der globalen Kapitalakkumulation und den (semi-)peripheren Staaten reproduzieren sich zum Teil ähnliche Muster der hierarchischen Arbeitsteilung und Abhängigkeit, wie wir sie auch von den alten kapitalistischen Zentren kennen. Teilweise erweitern sich durch die verschärfte Rivalität zwischen China und den alten kapitalistischen Zentren aber auch die Handlungsoptionen der (semi-)peripheren Staaten und der neuen aufstrebenden nationalen Bourgeoisien. Russlands Krieg in der Ukraine und der Versuch, seine Dominanz im postsowjetischen Raum zu verteidigen bzw. wiederherzustellen, wären ohne die Unterstützung Chinas kaum erfolgversprechend. Das gleiche gilt für die – inzwischen durch den Kollaps des Assad-Regimes und durch die israelische Offensive stark geschwächten – regionalen Ambitionen des Iran. Selbst von Kompradorenbourgeoisien beherrschte Länder, die weitgehend von Rohstoffexporten und Kapitalimporten abhängig sind, sind derzeit in der Lage, ihre Abhängigkeit von den USA und den früheren europäischen Kolonialmächten zu reduzieren, wie die Umbrüche in Westafrika zeigen. Andererseits ist der Krieg im Sudan ein Beispiel dafür, dass auch subimperialistische Mächte wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate eine verheerende Rolle spielen können.
Aufgabe der kritisch-marxistisch orientierten Wissenschaft ist es, nicht in primitives Schwarz-Weiß-Denken nach dem Motto »Die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde« zu verfallen, sondern die Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse in der gesamten kapitalistischen Staatenwelt einer genauen Untersuchung und Kritik zu unterziehen. Für sozialistisch orientierte Kräfte stellt sich dabei die Frage, an welchen Gliedern der »imperialistischen Kette« (Lenin) sich die Widersprüche dermaßen verdichten, dass sie durch soziale Revolutionen gesprengt werden kann. Im Übrigen gilt angesichts der aktuellen Aufrüstungspläne in Deutschland das Motto Karl Liebknechts: Der Hauptfeind steht im eigenen Land!