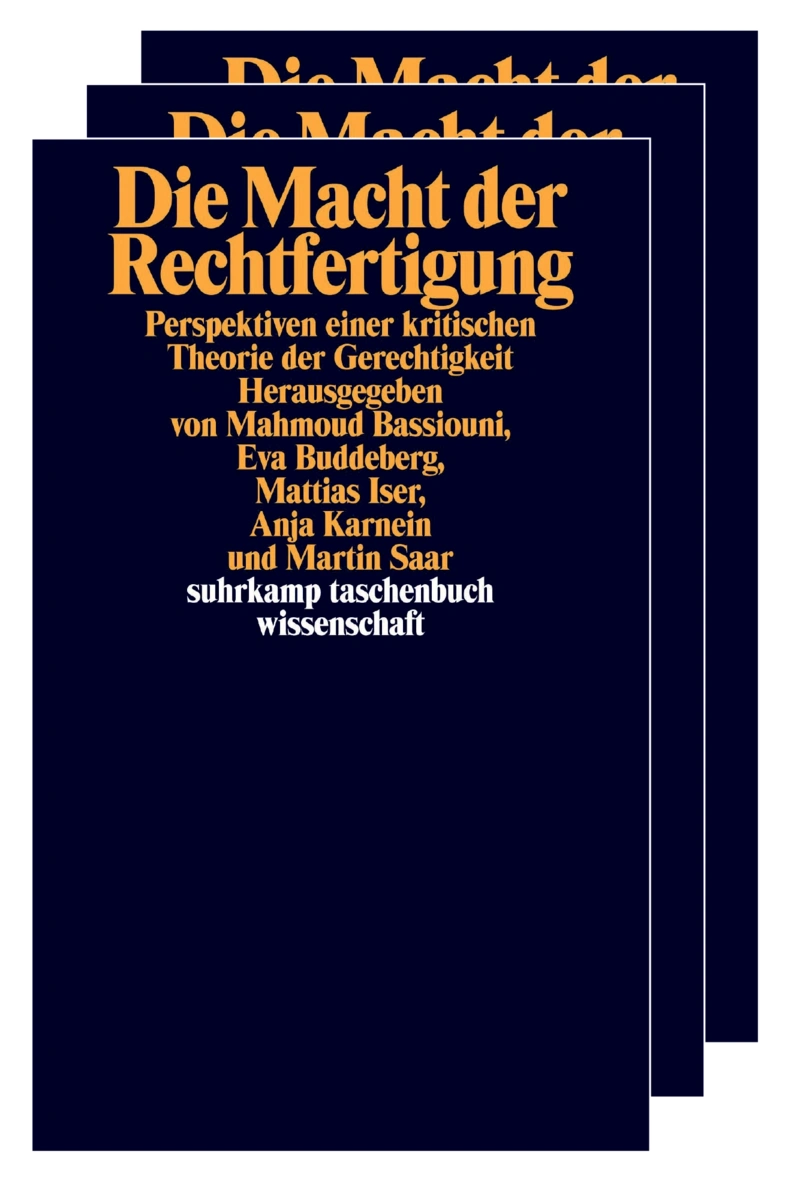
Ob mit oder ohne Forst: Hauptsache dagegen. Eine Replik auf eine Rezension
In unserer Herbstausgabe vergangenen Jahres erschien eine Rezension zu dem Sammelbad »Die Macht der Rechtfertigung«. In der aktuellen Ausgabe wird die Rezension nun selbst zur Rechtfertigung aufgerufen. Die neue Rezension vertieft die Frage, wie eigentlich kritische Auseinandersetzung gelingen können.
Im Herbst 2024 erschien in der AStA-Zeitung eine ärgerliche Rezension der Festschrift Die Macht der Rechtfertigung. Perspektiven einer kritischen Theorie der Gerechtigkeit unter dem Titel »Mit Forst gegen Forst denken«1. Ärgerlich nicht etwa wegen der vom Rezensenten vertretenen These, Rainer Forst sei ein »bürgerlicher Philosoph«, die doch schließlich, verbringt man ein wenig Zeit unter Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften in Frankfurt, kaum weniger radikal sein könnte, sondern vielmehr wegen des Mangels an Begründung (man möchte beinahe sagen, an Rechtfertigung) dieser These. Wahrscheinlich ist dem Autor das Nehmen und Geben von Gründen schon deshalb suspekt, weil er damit eine der zentralen Prämissen von Forsts Philosophie bereits akzeptieren müsste, nämlich dass wir nicht nur zur Rechtfertigung prinzipiell fähige, sondern gar dazu verpflichtete Wesen sind.
Dieser Mangel an Gründen überrascht. Schließlich bezeichnet der Rezensent die These der Herausgeber*innen des Bandes, dass Forsts Ansatz der Kritischen Theorie zuzuordnen sei, als unbegründete »Setzung« – um anschließend selbst im Modus der Setzung zu verbleiben. Denn anstatt dem Titel der Rezension entsprechend die Ansprüche der Theorie gegen ihren Inhalt zu wenden, werden den Behauptungen des Gegners bloß jeweils eigene Behauptungen entgegengestellt. So wird die von Forst vertretene ethische Neutralität des Staates kurzerhand als »liberales Phantasma« beanstandet, ohne auf die komplexe Fragestellung einzugehen, auf welcher argumentativen Basis sich die Privilegierung einer ethisch gehaltvollen Lebensform vor anderen behaupten lässt. Zudem wird beklagt, dass Forsts Theorie weniger mit dem Kapitalismus zu tun habe und mehr mit »Gerechtigkeitsparadigmen, Rechtfertigungsverhältnisse[n] und Republikanismus«, wobei der Kläger die Leser*innenschaft dabei im Dunkeln lässt, ob es nicht Einwände gegen einen normativ blinden Materialismus geben könnte, die einen solchen Paradigmenwechsel ursprünglich motivierten – Einwände, die man dann im Anschluss zurückweisen könnte.
Offene Türen und trockenes Versichern
Diese Reihe an Setzungen mündet in dem erwähnten Appell, Forsts Denken als das zu entlarven, was es eigentlich sei: ein bürgerliches, das »offensichtlich mehr Bezug zu Immanuel Kant und John Rawls aufweist als zu Marx«. Doch auch hier ersetzt der ketzerische Klang der Autorennamen, zu denen sich Forst ja ganz offen bekennt, das Argument, warum deren Ansätze für eine Kritische Theorie prinzipiell unbrauchbar sind. Am Ende bleibt nur das obligatorische Horkheimer Zitat: irgendwas mit Menschen, Sein und Veränderung.
Ganz abgesehen von der Frage, warum der Autor bemüht ist, mit einer solchen Vehemenz offene Türen bei seinem Publikum einzurennen, ist es bedauernswert, dass dadurch ein Moment genuiner Theoriekritik verpasst wird. Wie eine solche eigentlich aussehen könnte, verrät ein Blick in die Einleitung zu Hegels Phänomenologie des Geistes, die ja auch für den in der Rezension vertretenen Kanon an Denker*innen nicht uninteressant ist. Darin heißt es:
Denn sie [die wahre Wissenschaft] kann ein Wissen, welches nicht wahrhaft ist, weder als eine gemeine Ansicht der Dinge nur verwerfen und versichern, daß sie eine ganz andere Erkenntnis und jenes Wissen für sie gar nichts ist […]«, denn schließlich »[gilt] ein trockenes Versichern […] gerade soviel als ein anderes«.2
Für unseren Fall bedeutet dies, dass das »trockene Versichern« der Wahrheit der Annahmen des Rezensenten (Stichwort »liberales Phantasma«) genauso viel gilt, wie das »trockene Versichern« der Wahrheit der Theorie, gegen die er sich wendet – nämlich gar nichts. Der geschicktere Weg wäre es, die kritisierte Theorie mit ihren Voraussetzungen zu konfrontieren, um sie in einen Widerspruch mit sich selbst zu führen. Denn auf diese Weise muss man nicht mit äußeren, eigenen Prämissen an die Kritik gehen, die man selbst erst noch zu begründen hätte – etwa, dass das marxistisches Staatsverständnis notwendig wahr sei. Wie das Aufweisen solcher Widersprüche funktioniert, deutet Hegel in der Einleitung gleich selbst in Bezug auf die kantische Philosophie an,3 um schließlich in der Phänomenologie des Geistes alle möglichen Gestalten des Wissens nach diesem Muster zu zerlegen; mit dem erklärten Ziel, die Alternativlosigkeit der eigenen Position deutlich zu machen. Wie könnte nun eine immanent-kritische Auseinandersetzung mit dem Kantianer Forst aussehen?
Politische Theorie oder Moralhimmel?
Das offenbart ein Blick über den Tellerrand der Einleitung hinaus in den tatsächlichen Sammelband. Darin wendet sich Jürgen Habermas in einem Beitrag mit dem Titel Zum Modus der Sollgeltung moralischer Aussagen gegen seinen ehemaligen Schüler. Er beklagt, dass Forst seine Philosophie zwar auf den ersten Blick als dezidiert politische Theorie aufziehe, da es diesem gerade nicht darum gehe, in einem ersten Schritt abstrakte Gerechtigkeitsprinzipien isoliert am Schreibtisch aufzustellen, die dann in einem zweiten Schritt auf real existierende Gesellschaften angewandt werden – vielmehr sei Forst an konkreten Rechtfertigungsgemeinschaften interessiert, in denen sich real existierende Subjekte über die Normen, denen sie unterworfen sind, einander Rechenschaft schulden.
Aus dieser normativen Verantwortlichkeit leite Forst ein fundamentales Recht aller Bürger*innen auf Rechtfertigung ab. Mit diesem korrespondiere jedoch ebenso eine moralische Pflicht zur Rechtfertigung, die sicherstelle, dass die Subjekte von diesem Recht auch tatsächlich Gebrauch machen sollen. Das ist nur konsequent, denn anders als Habermas selbst kann Forst die Pflicht nicht im » ›existentiellen Interesse‘ an einer kommunikativen Lebensform«4 wurzeln lassen – will er doch in kantischer Manier die Moral auf eine ihr eigene Normativität gründen.5 Das führe Forst allerdings dazu, die Rechtfertigungspflicht an eine »Einsicht zweiter Ordnung« zu knüpfen6; eine Einsicht nicht allein in die Richtigkeit derjenigen Normen, die sich diskursiv bewährt haben, sondern in das Faktum, dass wir anderen Subjekten gegenüber prinzipiell an einen solchen Diskurs gebunden sind. Abgesehen davon, dass die Art dieser Einsicht, die auch als »moralische Wahrnehmung«7 bezeichnet wird, einigermaßen mystisch bleibt, wird Forst Habermas zufolge damit seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Diese bestünden ja gerade darin, die kantische Moral vom Himmel der transzendentalen Moral auf die Erde der Rechtfertigungspraktiken von »vergesellschafteten Subjekten aus Fleisch und Blut«8 zu holen. Indem Forst nun aber moralische Einsichten begründe, die der konkreten politischen Rechtfertigung ontologisch vorgeordnet seien, misslinge dieser Versuch einer »Detranszendentalisierung«9: Was auf den ersten Blick als politische Theorie daherkomme, entpuppe sich als Moralphilosophie, die drohe, den Kontakt mit der Wirklichkeit zu verlieren.
Genau diese moralische Distanzierung von den politischen Verhältnissen kann womöglich die materielle Blindheit erklären, die der Rezensent bei Forst so deutlich beklagt. Indem man die Theorie auf diese Weise mit sich selbst in Konflikt bringt, gelangt man jedoch zu einer wirksameren Kritik an dieser Blindheit, die auf das »trockene Versichern« von als selbstverständlich angenommenen Wahrheiten verzichtet. Denn in diesem Fall ist Forsts Theorie – sei sie nun »bürgerlich« oder nicht – einem viel gravierenderen Problem ausgesetzt: Sie erscheint als weniger rechtfertigbar.
-
1
Online: https://asta-zeitung.de/artikel/mit-forst-gegen-forst-denken
-
2
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Gesammelte Werke. Bd. 9. Phänomenologie des Geistes, hrsg. Von Wolfgang Bonsiepen und Reinhard Heede, Düsseldorf 1980, S. 55.
-
3
Vgl. ebd., S. 53 f.
-
4
Forst, Rainer, Das Recht auf Rechtfertigung. Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit, Berlin 2014, S. 93.
-
5
Vgl. hierzu auch Forsts Kritik an Habermas ebd., S. 91 ff.
-
6
Habermas, Jürgen, »Zum Modus der Sollgeltung moralischer Aussagen. Zwei Varianten der Detranszendentalisierung«, in: Mahmoud Bassiouni et al. (Hrsg.), Die Macht der Rechtfertigung. Perspektiven einer kritischen Theorie der Gerechtigkeit, Berlin 2014, S. 125-152, hier S. 134.
-
7
Forst, Das Recht auf Rechtfertigung, S. 71.
-
8
Habermas, Zum Modus der Sollgeltung moralischer Aussagen, S. 134.
-
9
Ebd.