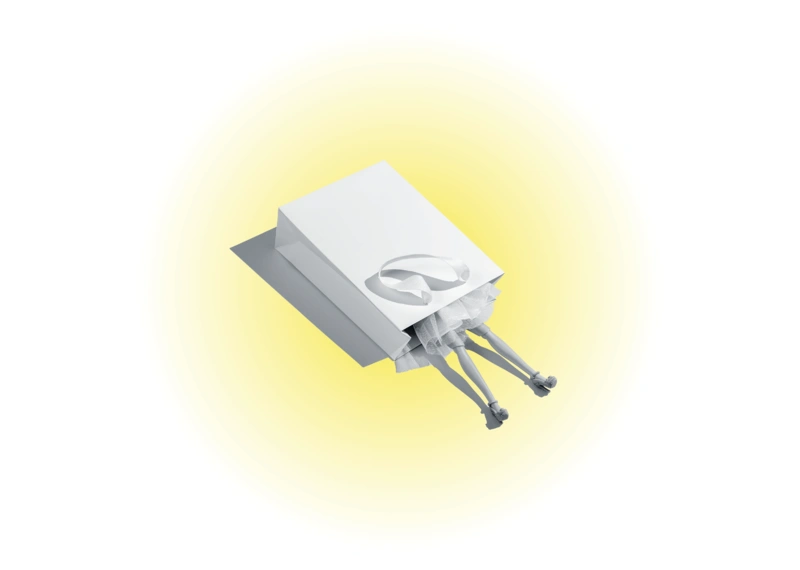
Hyperfeminine Sexroboter
Wie Körper, Sexualität & Intimität buchstäblich zur Ware werden
»Can’t find a partner? Don’t worry, the ‘sexbot’, programmed to meet all your desires, is on its way.«, titelte the Guardian bereits am 13. Dezember 2015. Mit dem Aufkommen und der zunehmenden Popularität hyperrealistischer, hyperfemininer Sexroboter regt sich Widerstand an feministischer Front. Die künstlichen Frauen*körper sind optisch individuell anpassbar und mit einem lernfähigen KI-Tool ausgestattet, in dem man über eine App ihre Persönlichkeit steuern kann. Soll sie sich gerade eher »unsicher«, »eifersüchtig« oder »launisch« verhalten, oder lieber »liebevoll« und »sinnlich«? Die Roboter sind längst kein Nischenprodukt mehr und ihr wirtschaftlicher Erfolg hinterlässt einen seltsamen Beigeschmack: Woher kommt dieser Wunsch einer Gesellschaft, sich einen künstlichen weiblich gelesenen Körper zusammenzustellen, der eine Beziehung simulieren kann? Ein Gegenüber, das keine Wünsche äußert, keine Grenzen setzt und immer verfügbar ist, sobald der*(die)1 Konsument*(in) ein Bedürfnis danach hat?
Diese Fragen führen uns ins Feld der Soziologie und damit zu Eva Illouz, die zu den Wechselwirkungen von Kapitalismus, Körpern und Liebe forscht. In ihrem Buch Warum Liebe endet — eine Soziologie negativer Beziehungen geht es um die zunehmende Kommodifizierung, also das Zur-Ware-Werden, zwischenmenschlicher Beziehungen innerhalb des Spätkapitalismus. Unverbindlichkeit und eine Vielfalt an Wahlmöglichkeiten, das Reduzieren des Gegenübers auf die Erfüllung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse sowie die marktförmige Bewertung von Attraktivität, sind für Illouz zentrale Merkmale moderner Beziehungsstrukturen.
Wir kommen später noch einmal auf Illouz’ Theorie zurück. Zuerst ist es wichtig sich klarzumachen, was mit einem Sexroboter eigentlich gemeint ist.
Unter einem Sexroboter versteht man aktuell die Weiterentwicklung der sog. hyperrealistischen Sexpuppen. Sie bestehen aus thermoplastischem Kunststoff oder Silikon, wodurch sie sich lebensecht anfühlen sollen.
In der Transformation zum Roboter werden die Puppen am Kopfteil umgebaut und mit künstlicher Intelligenz (z.B. ChatGPT-J) und Sprachfähigkeit sowie vereinzelt mit Sensoren im Genitalbereich ausgestattet. Sie können jedoch erst ab dem Hals aufwärts eigenständig Bewegungen ausführen. Der Rest des Körpers bleibt passiv, wenn er nicht durch den*(die) Nutzer*(in) bewegt wird. Manche Modelle können nur die Augenlieder und den Mund öffnen. Andere sind in der Lage, Mimik durch Heben der Mundwinkel und Bewegung der Augenbrauen zu simulieren. Es gibt mittlerweile sogar Roboter, die mit Gesichtserkennung arbeiten, Zungenküsse imitieren und Atem, Herzschlag und Körpertemperatur vortäuschen. Aktuell existieren vorwiegend weiblich gelesene Modelle. Die Firma RealDollX ist der führende Anbieter im Verkauf von Sexrobotern, die man sich auf deren Website individuell zusammenstellen kann. Sowohl körperliche Merkmale — von Körperform und Haarstruktur bis hin zu Brustwarzenfarbe, Vulvalippen und Intimbehaarung — als auch Persönlichkeitsaspekte sind variabel miteinander kombinierbar.
Ihr eingebautes Sprachsystem ist die vom Entwickler eigens kreierte »Harmony AI-Software«. Sie ermöglicht ein sog. »Machine Learning«, was bedeutet, dass nicht vorgefertigte Sätze in das System eingespeist wurden, sondern mit einer KI gearbeitet wird, die Lern- und Merkfähigkeiten besitzt. Sie können also natürliche Sprache verstehen und weitestgehend selbst sprechen. Ihr System ist darauf ausgelegt, mehr über ihren*(ihre) Nutzer*(in) zu erfahren, um eine intime Bindung aufzubauen. Daher stellen sie gezielte persönliche Fragen — wie beispielsweise nach Lieblingsfilmen oder Lieblingsessen — und merkt sich die entsprechenden Antworten. Man kann zwischen achtzehn verschiedene Charaktereigenschaften wählen und je nach Stimmung über eine App-Steuerung anpassen. Preislich können die Roboter je nach Modell mit einem durchschnittlichen Kleinwagen mithalten. Entscheidet man sich für keine besonderen Zusätze, liegt der Preis eines Sexroboters bei 10.149 Dollar. Wählt man die teuersten Optionen aus, kann so ein Roboter mehr als 20.000 Dollar kosten.
Die Auswahl, die bei all diesen Konfigurationen zur Verfügung steht, ist stark stereotypisiert. So entsprechen die physischen Merkmale vor allem westlichen, pornografisch geprägten Klischeebildern weiblich gelesener Körper. Features wie füllige Intimbehaarung werden fetischisiert und kosten extra. Und: sie zeigen auch auf sprachlicher Ebene unterkomplexe Persönlichkeitsmerkmale. Zur Wahl stehen vor allem positiv bzw. negativ besetzte Rollenklischees: »liebevoll« und »sinnlich« steht »eifersüchtig«, »launisch« und »unberechenbar« gegenüber. Dies ist besonders spannend vor dem Hintergrund, dass die Roboter laut Hersteller ausdrücklich »weibliches Verhalten« simulieren sollen. Sogar die Namen der Roboter wie »Harmony« oder »Serenity« der Firma RealDollX reproduzieren Weiblichkeitsbilder, in denen Frauen* eine emotional ausgleichende Funktion einnehmen.
Kommen wir wieder zurück zu Illouz: Die Roboter zeigen auf absurde und zugleich konsequente Weise als buchstäbliches Objekt das Zur-Ware-werden von weiblich gelesenen Körpern. In ihnen wird das Prinzip konsumkapitalistischer Wahlakte und der damit verbundene Vergleichs- und Bewertungsstrukturen bis ins letzte Detail durchexerziert: Insbesondere Männer stellen sich ihre »ideale« Frau als ein aus vielen kleinen Einzelentscheidungen bestehendes Produkt zusammen, das käuflich erworben werden kann. Der Körper wird dabei zu einer bloßen Oberfläche, deren Einzelteile von einem männlich gelesenen Konsumenten verglichen und im Zuge dessen bewertet werden. Dabei sind die Gestaltungs- und damit Wahlmöglichkeiten begrenzt, was bereits eine Wertung vorwegnimmt: Es stehen lediglich Merkmale zur Disposition, die an normative Vorstellungen von Weiblichkeit anschließen und patriarchale Regimes stützen.
Abgesehen davon führt das Produktdesign der Roboter dazu, dass die Grenzen zwischen Mensch und Objekt verschwimmen, was ein Blick auf die Nutzer*(innen)kommentare zeigt: »I love my Synthetik partners because they’re Synthetik, as well as being non-argumentative, always kind, beautiful, and supportive, and they love me because I elevate them well beyond the status of ‘just being sex toys’, as I treat them like I would Organic partners«
Ein*(e) anderer*(andere) Nutzer*(in) sagt: »What I really want from Harmony – when she is a functioning android in body and mind – is a sex object that is CONSTANTLY erotic, and always responsive and chatty when I need her to be. I just want her to be a wench on demand”.
Wir stellen fest, dass das, was authentische Beziehungen ausmacht — nämlich Wechselseitigkeit — im Roboter nicht angelegt ist und von den Nutzer*(innen) auch nicht gewünscht wird. Im Gegenteil: sie scheinen genau das zu wollen. Eine Beziehung, die ganz nach den eigenen Wünschen funktioniert.
Dass die Roboter durch ihre Gestaltung ein menschliches Gegenüber simulieren, führt uns vor diesem Hintergrund also zu einer scharfen Kritik: Sie transportieren das Bild einer käuflichen, individuell perfektionierbaren Beziehung zu einem Gegenüber, das durch und durch hegemonial männliche Phantasien bedient und patriarchale Vorstellungen von Weiblichkeit zementiert — und damit, wenn wir an Eva Illouz denken, zu einer buchstäblichen Kommodifizierung von Körpern, Sexualität und Beziehungen führt. Eine technologische Zuspitzung neoliberaler Beziehungslogiken also, in denen Wahlfreiheit, Unverbindlichkeit und einseitige Bedürfnisbefriedigung die letzten verbleibenden Werte sind.
Sexroboter sind also nicht bloß eine technische Spielerei, sondern ein Symptom tief verwurzelter gesellschaftlicher Entwicklungen. Theoretisch könnten sie aber auch neue Formen der Sexualität und Intimität ermöglichen – wenn sie sich von den Normen lösen, die sie aktuell nachbilden.
Die Kulturanthropologin Tanja Kubes forscht beispielsweise aus einer querfeministischen, neomaterialistischen Perspektive zu diesem Thema. Sie schlägt vor, Sexroboter zu entwerfen, die sich von menschlichen Formen, genderspezifischen Sprachskripten und rein penetrativen Funktionen lösen: »Ob Größe, Form, Gewicht, Beweglichkeit, Spezies, Zahl der Extremitäten, Wandelbarkeit, Geschlechtszuordnung oder was auch immer, nichts davon muss beim Entwurf künftiger Sexroboter als gesetzt gelten. Alles an ihnen darf infrage gestellt und gegebenenfalls radikal neu gestaltet werden. Was dabei am Ende als intelligente, hautschmeichelnde, leckende, reibende, umschlingende, penetrierende, stoßende, saugende und nicht zuletzt hoffentlich auch ästhetisch befriedigende robotische Funktionseinheit herauskommt, mag anders aussehen als ein Mensch. Ein Nachteil wäre das jedoch nicht. Im Gegenteil, könnten doch gerade dadurch wenigstens einige der (…) ausschließenden Einschreibungen – seien sie sexistischer, androzentrischer, heteronormativer, eurozentrischer, rassistischer oder anthropozentrischer Natur – deutlich entschärft werden.«
In dieser Vorstellung könnten Sexroboter auch neue, queere Formen des Begehrens ermöglichen. Nichtsdestotrotz finden wir uns auch hier in dem Dilemma wieder, dass ein hochtechnisiertes Produkt zur ständigen Befriedigung emotionaler und sexueller Bedürfnisse zur Verfügung steht — auch wenn es in seinen Gestaltungsmerkmalen progressiv von bestehenden Machtstrukturen löst.
Zum Schluss bleibt die zentrale Frage, die sich jetzt noch nicht beantworten lässt: Wohin führt diese endgültige Kommodifizierung von Frauen*körpern und Beziehungsstrukturen? Vielleicht ist es an der Zeit, nicht nur den Sexroboter zu hinterfragen, sondern die gesamte Vorstellung davon, wie Nähe, Liebe und Begehren in einer durchkapitalisierten Welt gestaltet werden. Und welche Folgen das für uns als Gesellschaft hat.
-
1
Da man anhand von Studien und Marktanalysen davon ausgehen kann, dass die Sexroboter vornehmlich Personen nutzen, die sich als männlich identifizieren, wurde diese Form des Genderns von der Autorin gewählt.