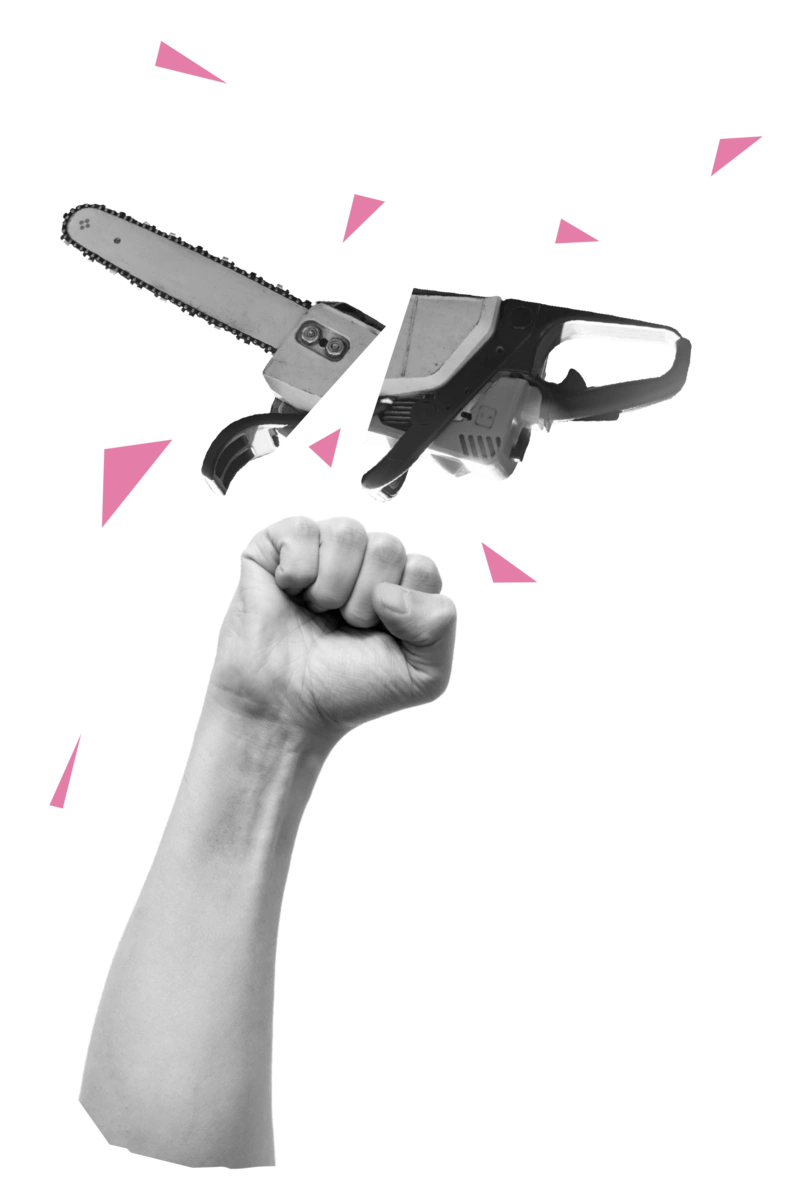
Die sichtbare Hand des Marktes
Austerität und die offenen Adern Lateinamerikas
Muss man Austerität sonst als bittere, aber ökonomisch notwendige Pille verkaufen, zelebriert Javier Milei sie euphorisch – mit Kettensäge im argentinischen Wahlkampf. Die Botschaft: radikaler Wandel in einem Land, das seit Jahrzehnten in einem Strudel aus Schulden, Währungskrisen und IWF-Auflagen gefangen scheint.
Argentinien ist mit Abstand der größte Schuldner des Internationalen Währungsfonds (IWF). Schon 23 Mal erhielt Argentinien Kredite, zuletzt sogar unter der Präsidentschaft von Milei. Die IWF-Chefin Kristalina Georgieva begründet die erneute Kreditvergabe in einem Beitrag auf der Plattform X mit Verweis auf die »positive ökonomische Entwicklung des Landes«. Dazu zählt sie eine sinkende Inflation, den Ausgleich des Staatshaushalts und positive Wachstumsprognosen für das kommende Jahr. Auch wenn im März diesen Jahres die Inflationsrate »nur« noch 47,3 % betrug und somit gegenüber dem Höchstwert von über 200 % Ende des Jahres 2023 einen klaren Rückgang markiert, sind die Raten weiterhin hoch und wirken – vor dem Hintergrund von Einbrüchen in der Industrie und einer immer noch hohen Armutsquote von 38 % – weniger positiv. Abseits der Zahlen verkörpert Mileis Kettensägen-Politik jedoch weitaus mehr: eine aggressive Austeritätslogik, die den Sozialstaat zum absoluten Feind erklärt hat.
Clara E. Mattei zeigt in ihrem Buch »Die Ordnung des Kapitals. Wie Ökonomen die Austerität erfanden und dem Faschismus den Weg bereiteten«, dass Austerität keine ökonomische Sparsamkeit oder gar Notwendigkeit darstellt, sondern eine kapitalistische Machttechnik ist. Austerität dient der (Wieder-)Herstellung günstiger Akkumulationsbedingungen für das Kapital und der Festigung des Klassenverhältnisses. Indem Löhne gekürzt, Arbeitsrechte abgeschafft und hierarchische Strukturen durchgesetzt werden, soll die Arbeiter*innenklasse diszipliniert und die Profit-Maschinerie angekurbelt werden. All das bedarf jedoch staatlicher Intervention. Mileis Kettensägen-Performance ist demnach Ausdruck eines autoritären Liberalismus, der vorgibt, Freiheit zu fördern, und dabei Herrschaft stabilisiert. Wie Mattei kürzlich in einem Interview mit dem Jacobin-Magazin herausstellt, ist das Kürzungs-Programm Mileis nichts Neues in der Geschichte kapitalistischer Entwicklung. Dennoch stellt sich die Frage, welche spezifische Rolle Argentinien in der globalen Welle der Austeritätspolitik spielt.
Argentinien war schon früh Testlabor für neoliberale Strukturprogramme. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts begannen Regierungen, IWF und Weltbank, Kürzungen, Privatisierungen und Deregulierung zu diktieren; Argentinien sollte sich mit dem Ziel der Modernisierung einem internationalen Markt öffnen – ein Teufelskreis aus Schulden und Abhängigkeit begann. Austerität wird dabei zum Disziplinierungsinstrument einer peripheren Ökonomie, deren Handlungsspielraum durch internationale Verschuldung zunehmend eingeschränkt wird. Nicht Sparen ist hier das Ziel, sondern die Durchsetzung vor allem westlicher und kapitalfreundlicher Strukturen unter dem Deckmantel fiskalischer Verantwortung. Ein Blick in die Geschichte des ökonomischen Denkens Argentiniens zeigt jedoch, dass sich auch alternative Stimmen herausgebildet haben. Raúl Prebisch (1901–1986), Ökonom und Generalsekretär der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL), entwickelte im Anschluss an die Weltwirtschaftskrise 1929/33 eine strukturelle Kritik der Weltwirtschaft und orthodoxer ökonomischer Theorien. Sein Denken war stark beeinflusst vom britischen Ökonomen John Maynard Keynes. Er teilte die Auffassung der Instabilität eines Laissez-faire-Kapitalismus und der daraus abgeleiteten Notwendigkeit staatlicher Intervention. Gleichzeitig bemängelte er aber, dass sich die spezifischen Probleme lateinamerikanischer Ökonomien aufgrund ihrer strukturellen Abhängigkeit nicht nur durch nationale Nachfragesteuerung lösen lassen, ohne gleichzeitig auch die Bedingungen zu beseitigen, die die Abhängigkeit erst hervorrufen. Dies galt vor Allem für die rohstoffexportierenden Nationen. Aus dieser Erkenntnis geht schließlich die Prebisch-Singer-These hervor, nach der es – durch die besondere Stellung, die lateinamerikanische Länder in der kapitalistischen Weltmarktintegration einnehmen – zu einer sich fortsetzenden säkularen Verschlechterung der Terms of Trade kommen muss. Indem Länder des Globalen Südens hauptsächlich Rohstoffe exportieren und Industrieprodukte aus den industrialisierten Nationen importieren müssen, komme es zu einem sich ständig verschlechternden Tauschwert zulasten der Ersteren, die wiederum immer mehr Waren exportieren müssen, um die gleiche Menge an Importen aus den Industrieländern zu erhalten. Diese Dynamik führt nicht zu Entwicklung oder einem vorteilhaften Anschluss an den Weltmarkt, sondern zu wachsender Abhängigkeit – ein Prozess, der durch Schulden und Strukturanpassungsprogramme systematisch verstärkt wird. Angesichts dessen forderte Prebisch eine strategische Rolle des Staates im Umgang mit Schulden und lehnte Reformen nach orthodoxer liberaler Theorie ab, da sie die strukturellen Probleme eher verschärften als lösten. Stattdessen wollte Prebisch die autonome nationale Industrialisierung vorantreiben und forderte eine importsubstituierende Industrialisierung, die später starken Einfluss in der Politik der CEPAL ausübte. Die importsubstituierende Industrialisierung (ISI) verstand Prebisch als den Versuch, die Abhängigkeit von Industrieimporten aus dem globalen Norden zu durchbrechen, indem periphere Länder ihre eigenen Produktionskapazitäten gezielt durch staatliche Steuerung und Protektionismus aufbauen. Ziel ist nicht bloß ökonomische Entwicklung, sondern strukturelle Emanzipation von einem asymmetrischen und benachteiligenden Welthandel.

Mit seinem Denken begründet Prebisch den Beginn der Dependenztheorie, die sich gegen die zu der Zeit vorherrschende Modernisierungstheorie stellt und die den lateinamerikanischen Ländern diagnostizierte Rückständigkeit nicht als mangelnde Integration, sondern als Folge einer fortlaufend strukturell ungleichen Weltmarktintegration – die ihren Ursprung im Kolonialismus hat – darstellt. Schulden fußen vor diesem Hintergrund auf ungleichen und postkolonialen Strukturen. Sie sind Ausdruck der strukturellen Abhängigkeit Lateinamerikas vom globalen Norden. Die häufig unproduktive Verwendung der Schulden (z. B. zur Deckung von Haushaltsdefiziten) verschärft die wirtschaftliche Abhängigkeit dabei noch weiter. So beginnt das als Bibel der Dependenztheorie geltende Werk des uruguayischen Publizisten und Autors Eduardo Galeano »Die offenen Adern Lateinamerikas« mit den Sätzen:
»Die internationale Arbeitsteilung besteht darin, daß einige Länder sich im Gewinnen und andere im Verlieren spezialisieren. Unsere Region der Welt, die, die wir heute Lateinamerika nennen, war frühentwickelt: schon seit den fernen Zeiten, in denen die Europäer der Renaissance über das Meer vordrangen und ihre Zähne in die Gurgel schlugen, spezialisierte sie sich im Verlieren.«
Prebischs Forderungen, um die Spezialisierung im Verlieren aufgrund der strukturell ungleichen Arbeitsteilung in rohstoffproduzierende Peripherie und industrialisiertes Zentrum, zu beenden, ließen sich trotz seines zunächst großen Einflusses in der Wirtschaftspolitik Argentiniens und der CEPAL nicht wie erhofft durchsetzen. Die Entwicklung einer eigenen industriellen Basis war im von Prebisch und anderen Dependenztheoretikern analysierten ökonomischen und politischen Klima, sowie aufgrund eigener Widersprüche, nicht umzusetzen. Argentinien verschuldete sich unter verschiedenen Regierungen fortlaufend. Als dann 1979 die US-Notenbank im Zuge der sich zuspitzenden Krise und steigender Inflation den Leitzins drastisch anhob, stürzte Argentinien neben Mexiko und Brasilien in eine tiefe Staatsschuldenkrise. Die auf diesen sogenannten Volcker-Schock folgenden Jahre werden später als verlorenes Jahrzehnt bezeichnet und lassen IWF und andere internationale Gläubiger die Zügel gegenüber ihren Schuldnern noch enger ziehen.

Heute knüpft Milei den Wohlstand Argentiniens an eine stabile Währung, einen Rückgewinn des Vertrauens internationaler Finanzakteure sowie an eine Öffnung gegenüber internationalen Märkten. Dabei gilt: Der Staat ist schuld, der Markt soll es richten. Der Markt – wie auch immer er jedoch aussehen soll – kann jedoch nicht ohne Institutionen bestehen, die den Wettbewerb und das Privateigentum notfalls mit Gewalt durchsetzen. Oder, das lehrt uns Clara Mattei: Der Markt braucht einen autoritären Staat, der Austeritätspolitiken durchsetzt. Milei steht vor dem (neo)liberalen Dilemma: Freiheit predigen, aber autoritär handeln. Um die Menschen dem stummen Zwang der Marktkräfte zu überlassen, bedarf es zunächst der sichtbaren Hand des Staates, der entsprechende Bedingungen durchsetzt. Auch wenn Prebisch selbst an die Möglichkeit einer autonomen, auf liberalen Prinzipien beruhenden Entwicklung festhielt, zeigt seine Theorie struktureller Ungleichheit doch: Argentinien trägt bis heute das Erbe des Kolonialismus mit sich, das sich nach der formalen Unabhängigkeit von der iberischen Herrschaft im 20. Jahrhundert in einer ungleichen Einbettung in den Weltmarkt und einer strukturellen Abhängigkeit von kapitalistischen Zentren fortsetzt. Diese Abhängigkeit drückt sich in immensen Schulden gegenüber eben jenen Zentren, sowie gegenüber internationalen Gläubigerinstitutionen wie dem IWF und der Weltbank aus. So wie Prebisch betonte, dass Märkte in der Peripherie nicht neutral funktionieren, zeigt Mattei, dass auch Austerität nie eine rein ökonomische Notwendigkeit ist – sondern ein Projekt der Herrschaftssicherung unter dem Deckmantel marktwirtschaftlicher Vernunft.
Der Rückblick auf Prebisch und die Einbeziehung von Mattei eröffnen somit neue Perspektiven auf die Fragen: Wie sinnvoll ist Mileis Austeritätspolitik? Welche Rolle spielen (internationale) Gläubigerinstitutionen? Und was heißt heute »Planung«? Klar ist: Der kapitalistische Staat hat schon immer geplant. Die Frage ist: Wer sitzt im Planungsbüro – und, das würde Prebisch wahrscheinlich noch hinzufügen, in welcher Region der Erde steht es?