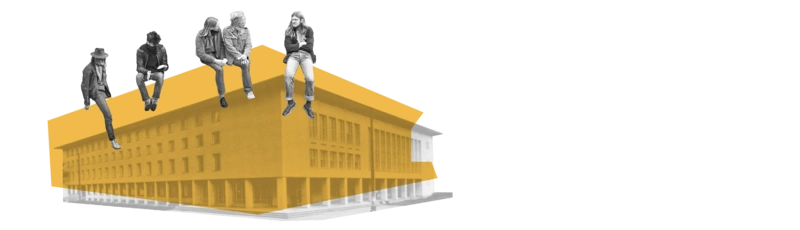
Dem Unwahrscheinlichen eine Zukunft geben
Gedanken zur Studihaus-Frage
Auf dem alten Unicampus in Bockenheim steht ein Gebäude, dessen Vergangenheit und Zukunft auf vielerlei Weise unwahrscheinlich zu nennen ist. Dass es vor gut 70 Jahren gebaut wurde, war alles andere als selbstverständlich, sondern verdankt sich einer besonderen Konstellation und mutigen Entscheidungen. Und dass es nach dem Wegzug der Uni aus Bockenheim eine Zukunft haben würde, galt lange Zeit als höchst abwegig, ist aber heute greifbar nah. Die Rede ist vom Studierendenhaus: einem seltenen Glücksfall für die Frankfurter Universität, welcher deren Geschichte in den vergangenen 70 Jahren entscheidend mitgeprägt hat. Und dem als selbstorganisiertes Kulturzentrum in schwierigen Zeiten noch eine wichtige Rolle für die Zukunft zukommen könnte.
Auf dem mittlerweile alles andere als neuen Unicampus im Westend indes steht kein Studierendenhaus. Das fällt den meisten vermutlich noch nicht einmal auf, denn es stehen ja genügend andere Gebäude herum, als dass man ein weiteres unbedingt vermissen müsste, dessen Möglichkeit ohnehin abstrakt und zunehmend ausserhalb des Erfahrungshorizonts bleibt. Doch diese Leerstelle, die mittlerweile fast ein Vierteljahrhundert andauert, ist eine schwelende Wunde, derer man sich erst bewusstwird, wenn man zurückschaut und sich vergegenwärtigt, was ein solches Haus sein und bewirken kann. Es soll hier also ein kurzer Blick in die Vergangenheit und Gegenwart gewagt werden, um mit dem so geschärften Blick, einer möglichen Zukunft Raum zu geben.
Als das Studierendenhaus Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts gebaut wurde, lag die Universität in Trümmern und hatte sich, was weit schwerer wog, als Institution gerade erst weitgehend diskreditiert. Der damals von aus dem Exil zurückkehrenden Wissenschaftlern vorangetriebene und von der amerikanischen Regierung unterstützte Bau eines Studentenhauses sollte denn auch in erster Linie der Re-Demokratisierung der Hochschule, und damit mittelbar der deutschen Gesellschaft als Ganzes dienen. Denn die damals Handelnden waren sich bewusst, dass die formale Existenz eines demokratischen Staates noch lange keine Demokratie ausmachte, sondern dass diese nur in einer sich immer wieder neu vollziehenden Praxis bestehen könne. Und das Studentenhaus wurde die materielle Grundlage für eine solche Praxis. Es stellte über Jahrzehnte die räumliche Basis für selbstorganisiertes Handeln dar, und es schuf ein Klima der Freiheit, in dem es möglich war, sich auszuprobieren, jenseits von Leistungsdruck zu diskutieren, kulturell tätig zu werden – oder einfach nur gemeinsam mit Kommiliton*innen eine gute Zeit zu verbringen. Und damit war es tatsächlich einzigartig: denn nirgendwo in Deutschland gab es – und gibt es bis heute – auch nur annähernd solch ein großes Gebäude, das den Studierenden zur freien Verfügung stünde.
Dieses mehr als 6000 Quadratmeter große Haus hat seine Wirkung in mancherlei Hinsicht entfaltet. Wie sehr einzelne Organe, Initiativen und Projekte aus ihm heraus nicht nur in die Universität, sondern auch in die Stadt Frankfurt und die ganze Bundesrepublik hineingewirkt haben, lässt sich schwer messen. Einige kurze Schlaglichter geben jedoch eine Ahnung:1 Da gab es seit den 50er Jahren den diskus, eine der fortschrittlichsten Zeitschriften der jungen Bundesrepublik. Es gab die neue bühne, die als Avantgarde-Theater die Rolle einer experimentierfreudigen Freien Szene einnahm, aus der wichtige Impulse für den kulturellen Aufbruch jener Jahre kamen. Hier kam es schon Anfang der 60er Jahre zur Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld und früher als anderswo zur Kritik am Krieg in Vietnam. Und natürlich gab es die Studentenbewegung von 1968, bei der Frankfurt neben Berlin die Schlüsselstellung in Deutschland zukam. Zentrale Ereignisse fanden hier statt, wie der Tomatenwurf im Festsaal, der für den Beginn der zweiten Frauenbewegung in Deutschland steht. In den 70er und 80er Jahren trafen sich hier unter anderem die Hausbesetzerszene, die Friedens- und die Umweltbewegung. Anfang der 2000er-Jahre war das Studierendenhaus die bundesweite Schnittstelle der erfolgreichen Bewegung gegen die Studiengebühren, und Anfang der 2010er Jahre das strategische Zentrum der Blockupy-Proteste. In den letzten Jahren schließlich fanden hier unter anderem die Auseinandersetzung um ein Recht auf Stadt und für einen menschenwürdigen Umgang mit Geflüchteten ihren Raum, und so mancher Klimastreik wurde vorbereitet.
Neben diesen Schlaglichtern nicht zu vergessen: das Studierendenhaus war und ist immer schon ein Ort zum gepflegten Abhängen – und vermutlich ist es erst dieser Alltag, der den Nährboden für alles weitere schafft. Hier lassen sich ohne Konsumzwang viele Stunden im Cafe KoZ verbringen, gibt es Barabende und Konzerte zu fairen Preisen, finden Fachschaftsparties und Karaokeabende statt, gibt es zweimal die Woche einen Film des vielfach preisgekrönten studentischen Programmkinos Pupille, gibt es Raum für Gruppentreffen, eine feministische Bibliothek und vieles mehr, was drumherum in der immer teurer und eintöniger werdenden Stadt keinen Ort mehr hat.
So weit, so gut? Vielleicht. Denn es könnte durchaus noch ein paar Jahre so weiter gehen. Doch genau dieses trügerische ›So Weiter‘ könnte sich am Ende als fatal erweisen. Denn die Zukunft dieses so wichtigen studentischen Raums steht derzeit auf dem Spiel. Und das betrifft sowohl das alte Studierendenhaus wie das neue.
Mit dem schrittweisen Umzug der Universität ins Westend ab 2001 geriet der Bockenheimer Campus, und mit ihm das Studierendenhaus, in einen Zustand des Dazwischens, der über lange Jahre hinweg durchaus seinen Charme hatte, heute aber sichtbar prekär geworden ist. Das Studierendenhaus, das einmal 24/7 der Aktivort der Uni war, erlebt seit langem einen schleichenden, aber nicht mehr zu übersehenden Niedergang. Was bereits 2001 mit dem Wegzug der Geisteswissenschaften begann, sich 2013 mit dem Freizug des AfE-Turms und der Räumung des Instituts für Vergleichende Irrelevanz (IVI) beschleunigte, ist spätestens seit der langen Schließung während Corona 2020/21 offensichtlich: dem Haus bröckelt die Grundlage weg. Ein Großteil der Räume ist die meiste Zeit über ungenutzt, das KoZ, zweifellos das Aushängeschild des Hauses, ist, trotz eines engagierten Teams und immer wieder neuen, teilweise gut laufenden Formaten, an vielen Tagen geschlossen oder schwach besucht und aktuell gar von Schließung bedroht. Zugleich ist offensichtlich, dass von Seiten der Universität nicht mal mehr das Nötigste investiert wird. Mit dem Effekt, dass aktuell etwa defekte Lüftungsanlagen den Betrieb stark einschränken und die Abwärtsspirale weiter befeuern.
Das Grundproblem liegt auf der Hand: das Studierendenhaus steht heute auf dem falschen Campus. Nämlich jenem, dem die Studierenden ausgegangen sind. Während der in den letzten Jahren enorm angewachsene ‘schönste Campus Europas‘ zwar Studierende hat, aber eben kein Haus für dieselben. Kam man als Studierende*r um die an zentraler Stelle des alten Campus gelegene Einrichtung einst nicht herum, wissen viele Studierende heute vermutlich nicht einmal mehr von deren Existenz.
An dem Fall zeigt sich exemplarisch die veränderte Haltung der Universität gegenüber ihren Studierenden. War das Studierendenhaus nach dem Krieg das erste Gebäude, das neu errichtet wurde, so wird das neue Studierendenhaus, falls es überhaupt noch kommt, so ziemlich das letzte sein, das gebaut wird. Und zwar nicht an zentraler Stelle, wie das Alte, sondern im buchstäblich hintersten Winkel des Areals, kurz vor dem Autobahnzubringer. 25 Jahre Aufschieben des Projekts durch wechselnde Uni-Präsidien sind auch ein Vierteljahrhundert, in dem die Studierenden es nicht geschafft haben, den ihnen zustehenden Bau durchzusetzen.
Doch noch ist es nicht zu spät. Im Augenblick scheint sogar ein selten guter Moment zu sein, um die Zukunft beider Häuser, endlich doch noch zu sichern. Das alte Studierendenhaus, dessen geplanter Abriss durch die Initiative Offenes Haus der Kulturen bereits verhindert werden konnte, steht nach 15 Jahren zäher politischer Arbeit kurz vor einer Zukunft als selbstverwaltetes soziokulturelles Zentrum, das den Geist des Studierendenhauses quasi in seine Zukunft nach dem Studium überführen möchte. Die Stadt Frankfurt hat unlängst eine unterschriftsreife Absichtserklärung (LOI) mit geradezu idealen Rahmenbedingungen angeboten: Übernahme des Gebäudes, Sanierung in Kooperation mit den Nutzer*innen und langfristig subventionierte Vermietung an den Trägerverein Offenes Haus der Kulturen, der diese günstigen Rahmenbedingungen an die vielen Initiativen weitergeben möchte, die das Haus heute und in Zukunft nutzen. Das Gute daran: der LOI garantiert dem AStA die vollen Rechte im alten Haus bis zum Umzug auf den Campus Westend – und sieht eine konkrete Absichtserklärung der Universität vor, das neue schnellstmöglich zu errichten.
Wenn es also gut läuft, könnte schon bald Bewegung in die Frage beider Häuser kommen. Doch das wäre auch höchste Zeit: denn in den kommenden anderthalb Jahren stehen diverse Wahlen an, und ob die politische Situation sich für solche emanzipatorischen Projekte danach weiterhin günstig darstellt, darf angesichts des aktuellen rapiden Rechtsrucks stark bezweifelt werden. Doch gerade dann wird es Räume brauchen, in denen eine reale und tätige Demokratie praktiziert wird – und somit vielleicht nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zur Ausweitung demokratischer Teilhabe beiträgt..
Wenn es also auf der Hand liegt, dass im Augenblick Entscheidungen forciert werden müssen, sind diese doch noch lange kein Garant für eine offene und demokratische Zukunft. Vielmehr wären diese erst der Startschuss, um die beiden Projekte, mit Leben zu füllen. Wie müssten solche Häuser emanzipativer Praxis heute aussehen, um in den kommenden 70 Jahren eine utopische Zukunft zu entwerfen? Um das herauszufinden, braucht es viele, die Lust auf die Gestaltung eines solchen Freiraums haben, und keinen Bock mehr, passiv auf eine scheinbar unvermeidbar düstere Zukunft zu warten. Also viel zu tun. Langweilig wird‘s sicher nicht.
-
1
Eine ausführliche Darstellung der Frühzeit des Hauses in den 50er und 60er Jahren bietet der Ausstellungskatalog: Kunst der Revolte. Revolte der Kunst, hg. Von Michaela Filla-Raquin und Andrea Keppler.