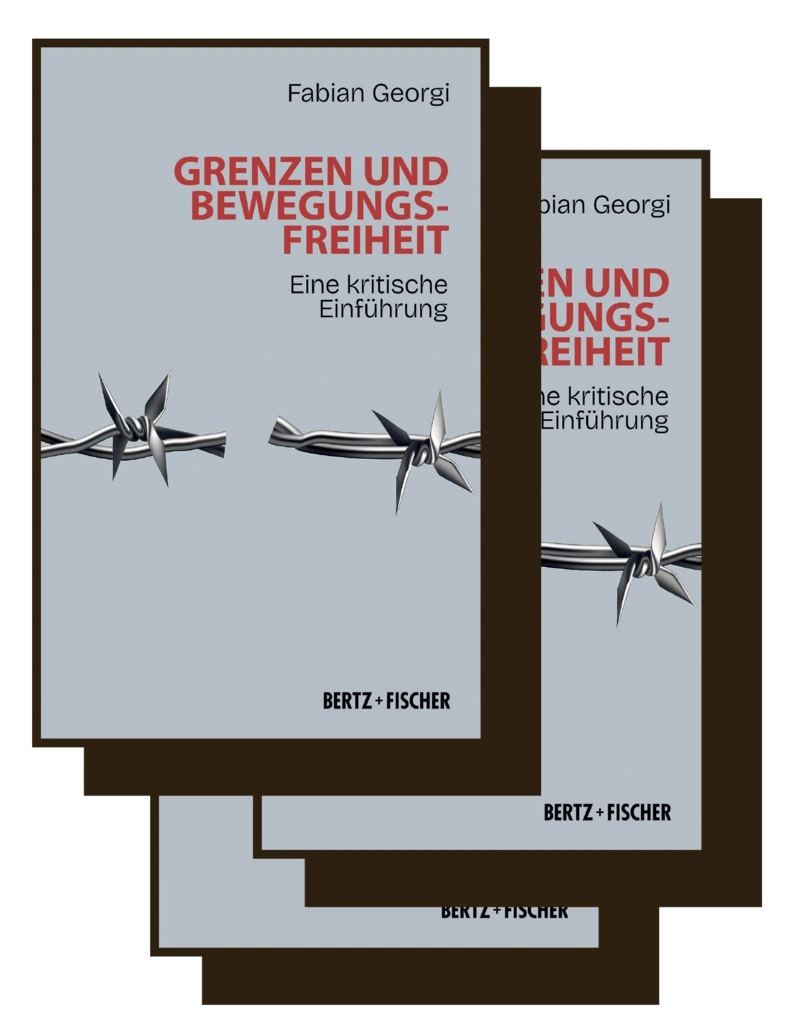
Lagos – Berlin: Globale Bewegungsfreiheit als konkrete Utopie
Eine Rezension zum Buch »Grenzen und Bewegungsfreiheit«
Fabian Georgi argumentiert in seinem 300 Seiten umfassenden Werk Grenzen und Bewegungsfreiheit dafür, dass letzteres »die emanzipatorische Position auf der Höhe der Zeit« ist – und bietet gleichzeitig eine hervorragende Einführung in die kritische Flucht- und Migrationsforschung.
Fabian Georgi, der an der Freien Universität Berlin promovierte und 2008 das Netzwerk für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung (kritnet) mitbegründete, untersucht in seiner Forschung – unter anderem im Rahmen der Forschungsgruppe »Staatsprojekt Europa« – Migrations- und Grenzregime aus einer materialistischen Perspektive. Seine aktuelle Publikation ist ein Versuch, wie er einleitend schreibt, »die oft abstrakte und idealistische Forderung nach offenen Grenzen historisch und materiell zu erden«.
Dabei bezieht er sich auf Karl Marx‘ kritische politische Ökonomie, die ältere Kritische Theorie sowie auf Debatten, Wissen und Theorien aus antirassistischen und anderen sozialen Bewegungen. Merklich spürbar ist zudem der Einfluss von regulationstheoretischen Überlegungen, neo-gramscianischen Perspektiven und der materialistischen Staatstheorie. Um Bewegungsfreiheit als Utopie kritisch-theoretisch zu fundieren, spielen Ernst Bloch und Erik Olin Wright eine zentrale Rolle. Zu Beginn sei das lediglich erwähnt, da es die kritische Einführung vermag, ebenfalls in diese Denktradition auf hervorragende Weise einzuführen.
Das Grenzregime historisch-materialistisch analysieren
Grenzen und Bewegungsfreiheit ist in drei Schritten aufgebaut: Analysieren, Begründen, Realisieren. Im ersten Schritt liefert Georgi in gewohnter historisch-materialistischer Manier eine geschichtliche Analyse über die Entstehung des (europäischen) restriktiven Migrationsregimes. So begann sich durch die Krise des Fordismus Anfang der 1970er Jahre das zu formieren, was Georgi selbst als sich formierenden Festungskapitalismus beschreibt. In den Klassenkämpfen im Globalen Norden und Süden setzte »sich eine Koalition sozialer Kräfte durch, die sich als transnationales neoliberales Hegemonieprojekt bezeichnen lässt«. Durch Deregulierung, Marktöffnung, Privatisierung und Fiskaldisziplin sollte Wachstum generiert werden, was global zu dramatischen Umwälzungen führte. Diese neoliberalen Krisenlösungsstrategien waren begleitet von Protesten und, um »derartige Widerstandspraktiken zu unterdrücken, gingen neoliberale Wachstumsmodelle von Anfang an mit autoritären Formen von Staatlichkeit einher«. Doch neben Protesten, die Georgi als »Voice-Strategien« bezeichnet, griffen Menschen ebenfalls auf »Escape-Strategien« zurück. Dabei sei das Muster historisch keinesfalls neu: Massenhafte Mobilität unterer Klassen als Reaktion auf Umwälzungsprozesse habe es in der Geschichte des Kapitalismus immer wieder gegeben.
»Die massiven Migrations- und Fluchtbewegungen, mit denen Menschen auf die Umwälzungen und Globalisierungsschübe der postfordistischen Epoche reagierten, können in diesem historischen Zusammenhang verortet werden.«
Auf diese eigensinnigen Migrationsbewegungen folgte eine restriktive Reaktion, die allerdings einherging mit Versuchen, »einen flexiblen Zugriff auf als nützlich geltende Arbeitsmigrant*innen zu erhalten«. Entsprechend ziele die von neoliberalen Akteuren vorangetriebene Politik des ›Migrationsmanagements‘ darauf, »eine ›regulierte Offenheit‘ für ökonomisch nützliche Arbeitskräfte mit einer effektiven Abwehr unerwünschter Bewegungen zu kombinieren«. Unterlegt mit Zahlen und Fakten legt Georgi anhand der multiplen Krise – mit dem Fokus auf die Klimakatastrophe – schließlich seine Konzeption der Formation des autoritären Festungskapitalismus dar, der als Begriff die »migrations- und grenzpolitischen Elemente innerhalb autoritär-chauvinistischer Krisenreaktionen konzeptualisieren« soll.
Ein ethischer Materialismus
Im zweiten Schritt begründet Georgi einen ethischen Materialismus, der die Grundlage, der im dritten Schritt dargelegten utopischen Flucht- und Grenzregimeforschung dienen soll. Ein Projekt eines kritisch-ethischen Materialismus bedarf, Georgi folgend, zweier Setzungen: Menschengemachtes Leid soll überwunden und die Entfaltung menschlicher Potenziale ermöglicht werden. Unter anderem Max Horkheimer, Vertreter der kritischen Theorie Frankfurter Provenienz, gilt Georgi dabei als Instanz, mit dem ein ethischer Materialismus zu begründen sei. Dem folgend betont er, dass die Idee offener Grenzen und die Politiken globaler Bewegungsfreiheit sich als Reaktion auf das Leiden und die Bedürfnisse von Menschen begreifen lassen:
»Sowohl die eigensinnigen, verdeckten Praktiken der Migration, des Ankommens und Bleibens, als auch die expliziten Forderungen aus sozialen Bewegungen sowie die wissenschaftliche Reflexion waren Reaktionen auf einen historischen Prozess von Krisen, Umwälzungen, Kämpfen und Repression.«
Die Forderung nach offenen Grenzen sei keine, die aus einem städtisch-studentischen Milieu entstanden ist, wie viele Kritiker*innen von offenen Grenzen propagieren würden. Sie speise sich aus den Praktiken und Kämpfen der Migration – und »aus den in diesen Kämpfen artikulierten Bedürfnissen und Aspirationen«. Flucht und Migration gehen dabei als Teilmomente transnationaler Klassenkonflikte aus der aktuellen Formation des Weltsystems hervor. Somit könne Flucht und Migration als ›wirkliche soziale Bewegungen‘ im Sinne von Marx aufgefasst werden.
»Sie richten sich – wenn auch subjektiv unbewusst – gegen die festungskapitalistische Variante des gegenwärtigen Weltsystems. Das Projekt globaler Bewegungsfreiheit kann sich auf diese materielle Tendenz stützen.«
Das Recht, zu kommen und nicht gehen zu müssen
Dabei betont Georgi, dass nicht die Idee unrealistisch sei, die in Teilen bereits gelebte Bewegungsfreiheit auszuweiten. Unrealistisch sei die Vorstellung, »angesichts des historischen Standes globaler Verflechtungen, der materiellen Realität transnationaler migrantischer Netzwerke und der eskalierenden Vielfachkrise möglich wäre, die Lebensweisen der globalen Arbeiter*innenklasse ohne ultra-gewaltvolle Repression in nationale Container zurückzustopfen oder sie dort zu fixieren«. Deshalb sei eine Politik globaler Bewegungsfreiheit die emanzipatorische Position auf der Höhe der Zeit – hinter der links-progressive Kräfte nicht zurückfallen dürften. Denn mit dem Projekt globaler Bewegungsfreiheit »korrespondieren sowohl materielle Tendenzen als auch subjektive Faktoren in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen«.
Natürlich dürfe dabei nicht die falsche Bewegungsfreiheit doppelt freier Arbeitskräfte mit dem emanzipatorischen Projekt verwechselt werden. Denn die freie Wahl zu haben, in welchem Elend man leben möchte, und der Zwang, die Arbeitskraft weltweit verkaufen zu müssen, sei – wenn überhaupt – falsche Freiheit. Aus diesem Grund kann die Politik globaler Bewegungsfreiheit nur als ein antikapitalistisches Projekt gedacht und umgesetzt werden.
»No borders, no nations«
Die problematischen Konsequenzen oder die dystopischen Szenarien einer von globaler Bewegungsfreiheit können, so Georgi, folglich auf vier Ebenen gedacht werden: den Zwang zur Mobilität, verschärfte Konkurrenz, ein faschistischer Backlash könnte die Reaktion sein oder die herrschenden Klassen könnten tausend kleine Festungen innerhalb des Ganzen schaffen. Diese dystopischen Szenarien, die aus nicht-intendierten Konsequenzen folgen könnten, ließen sich nur verhindern, wenn die Idee offener Grenzen systematisch mit der sozial-ökologischer Transformation zusammengedacht wird. Es sei auch entscheidend, das Projekt offener Grenzen mit einem Recht, nicht gehen zu müssen, zu kombinieren.
»Globale Bewegungsfreiheit kann aus materialistischer Sicht als konkrete Utopie gedacht und angestrebt werden, wenn man sie als Teilelement von sehr viel breiteren sozial-ökologischen Transformationen versteht. Deshalb ist die Frage, wie sich eine Welt offener Grenzen erreichen lässt, zugleich die Frage danach, wie sich die Transformation zu einer radikaldemokratischen und sozial-ökologischen Vergesellschaftungsweise vollziehen könnte.«
Im dritten und letzten Schritt widmet sich Georgi der Frage, wie Bewegungsfreiheit realisiert werden könne. Über soziale Interstitien, das heißt Nischen, Zwischenräume und Randbereiche, sollen andere Reproduktionsverhältnisse und Beziehungsweisen erprobt werden. Dort soll die angestrebte Alternative als Keim vorweggenommen werden. Dass diese bereits existieren, darauf weist Georgi ausdrücklich hin. Interstitien können dabei helfen, ein gegenhegemoniales Projekt der globalen Bewegungsfreiheit aufzubauen, denn sie dienen als reale Basis der Transformation. Doch auch durch einen radikalen Reformismus sollen die Spielräume erweitert und durch Einstiegsprojekte die Schritte zu offenen Grenzen für alle verwirklicht werden. Allerdings ist globale Bewegungsfreiheit nicht denkbar ohne einen revolutionären Bruch. Denn eine »Trendumkehr, ein Bruch mit festungskapitalistischen Tendenzen, bedarf wahrscheinlich harter Konfrontationen«.
Grenzen und Bewegungsfreiheit ist nicht nur eine Einführung in die kritische Grenzregimeforschung, sondern auch eine, die mit der Forderung nach offenen Grenzen, zur richtigen Zeit kommt. So düster die politischen Aussichten gerade sein mögen, Georgi bringt Licht und Argumente ins Dunkel und liefert dabei einen Begriffsapparat, den sich soziale Akteur*innen zu nutzen machen können, um wieder in die Offensive zu kommen und das Projekt globaler Bewegungsfreiheit voranzutreiben. Mit dem Verweis darauf, dass das »Bilderverbot« der kritischen Theorie ausgedient habe, stellt uns Georgi in einer eigenentworfenen Utopie präfigurativ vor, wie wir rückblickend auf das Projekt der globalen Bewegungsfreiheit schauen könnten:
»Die politischen Aspirationen, die sich Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts in den radikalen Spektren promigrantischer Bewegungen verdichteten, wurden im Zuge weiterer Transformationsprozesse realisiert. Ihre Vision eines ›No borders, no nations‘ wurde erreicht, als die Überreste alter Staatsapparate und öffentlicher Institutionen in eine radikal demokratisierte Gesellschaftlichkeit aufgehoben wurden.«